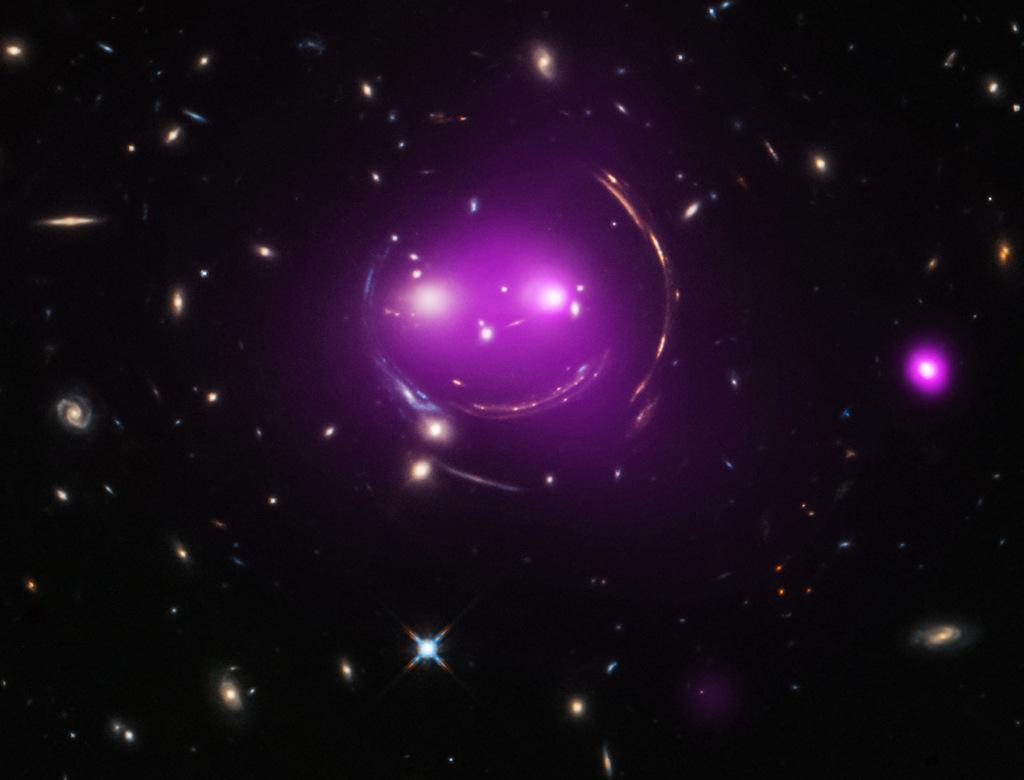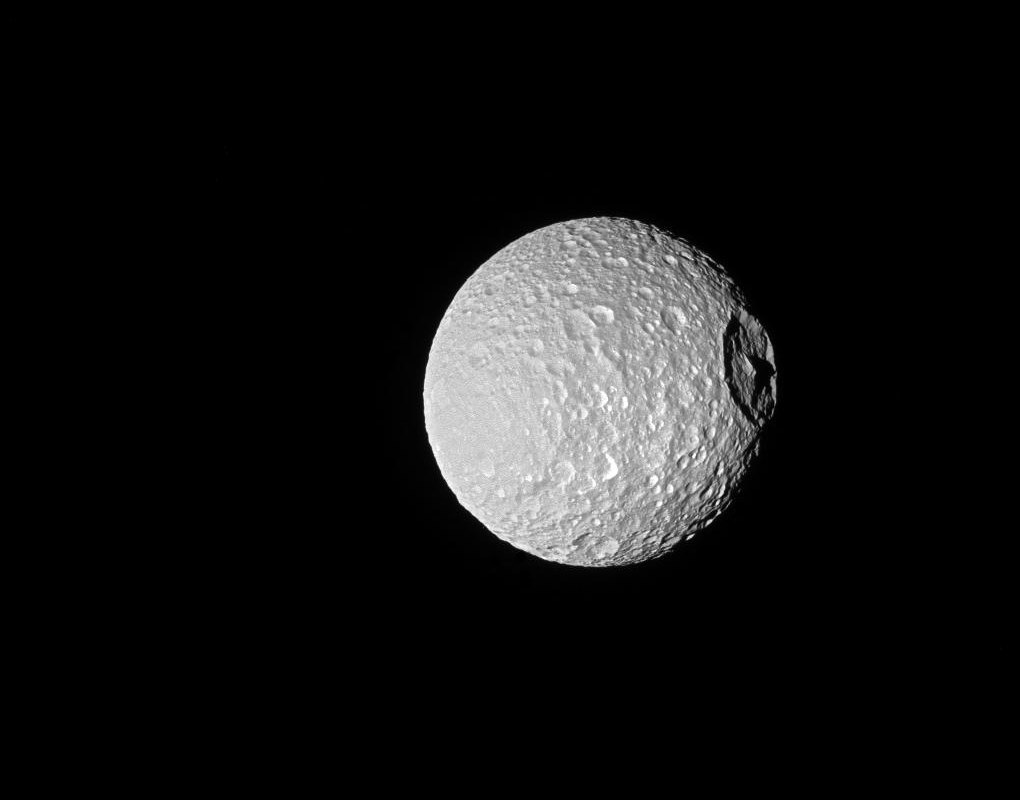Bildcredit und Bildrechte: Martin Pugh
Diese helle kosmische Wolke wurde von Sternwinden und der Strahlung junger heißer Sterne in Form gebracht. Die Sterne befinden sich im offenen Haufen NGC 3324. Vor einer taschenförmigen Region mit Sternbildung aus leuchtendem atomarem Gas zeichnen sich Staubwolken als Schemen ab. Die Region ist ungefähr 35 Lichtjahre breit und 7500 Lichtjahre entfernt. Sie liegt im nebelreichen südlichen Sternbild Schiffskiel (Carina).
Aufnahmen mit Teleskop wurden zu diesem Bild kombiniert. Sie wurden mit Schmalbandfiltern fotografiert. Diese Filter waren für die typischen Wellenlängen ionisierter Atome von Schwefel, Wasserstoff und Sauerstoff durchlässig. Dann wurden die Einzelbilder in roten, grünen und blauen Farbtönen kartiert. Diese Farben entsprechen der beliebten Farbpalette von Hubble.
In der himmlischen Landschaft leuchten helle Nebelwolken. Sie sind rechts von kühlem, undurchsichtigem Staub begrenzt. Manche erkennen hier das Gesicht einer bekannten Person im Profil, daher heißt die Region Gabriela-Mistral-Nebel. Sie ist eine chilenische Dichterin und Nobelpreisträgerin.
Hinweis: Der Text wurde nachträglich geändert