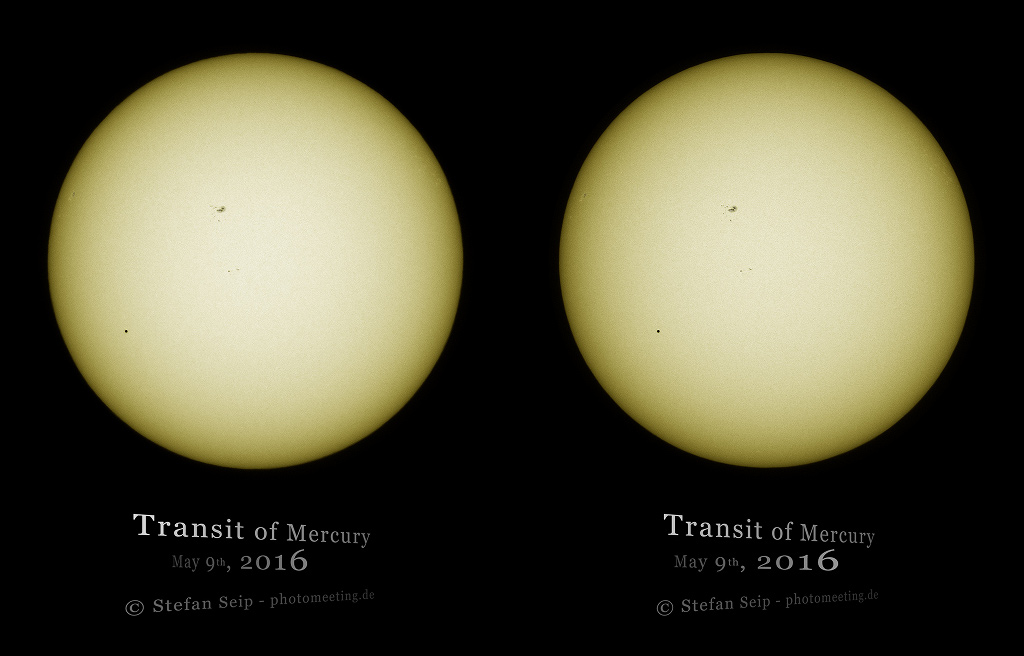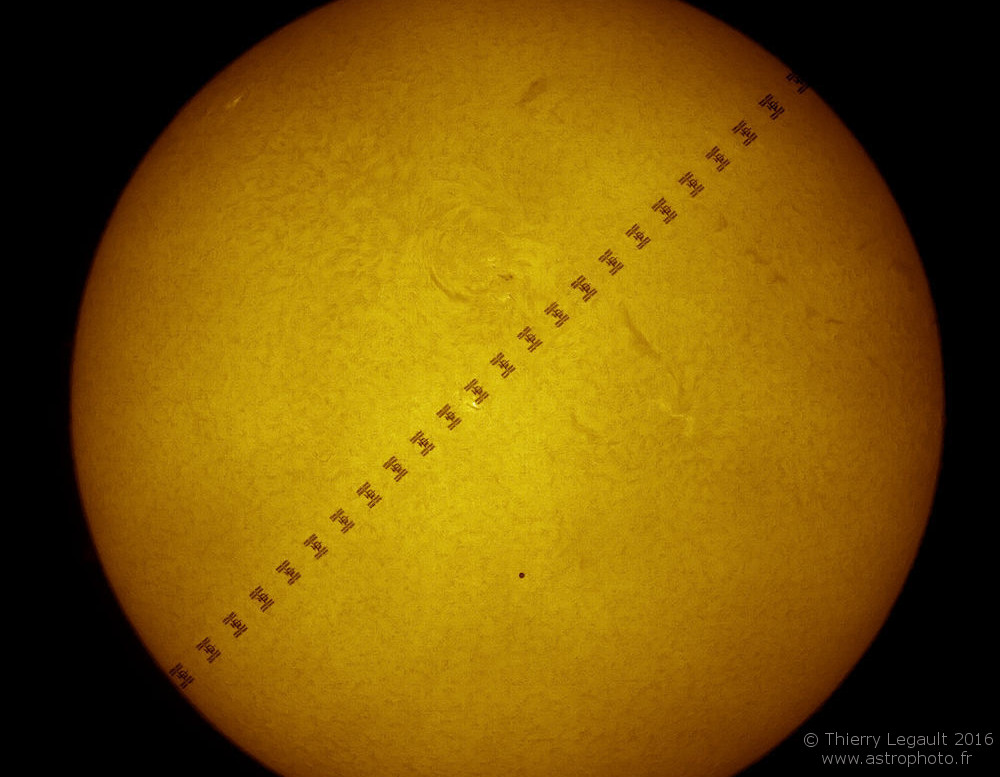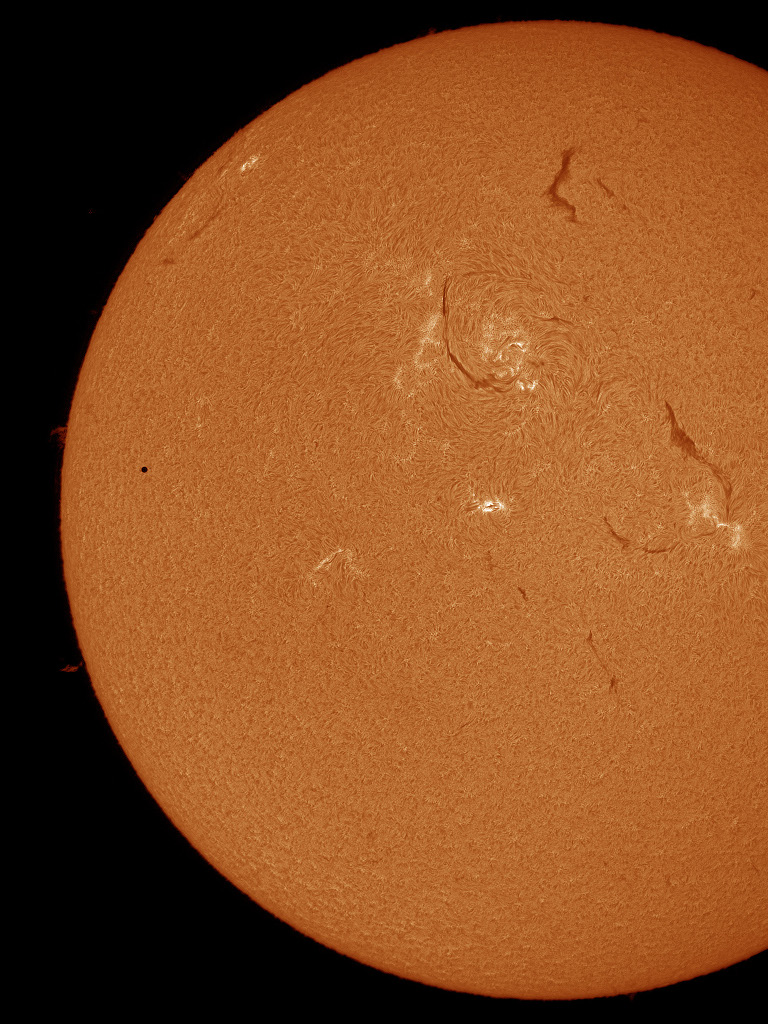Bildcredit und Bildrechte: Pierluigi Giacobazzi
Am 29. September stand Merkur in der Morgendämmerung beim Mond. Er war so weit von der Sonne entfernt, wie es ihm möglich ist. Der innerste Planet erreichte am Himmel des Planeten Erde fast seine größte Elongation. In der bunten Szene leuchtet Merkur links unter der abnehmenden Mondsichel, die von der Sonne beleuchtet ist. Die Nachtseite des Mondes wird von der Erde beleuchtet. Der neue Mond lag in den Armen des alten Mondes.
Unten steht die italienische Astrophysikalische Radiostation Medicina. Sie befindet sich in der Nähe von Bologna. Eine Reihe niedriger Antennen gehört zur ersten italienischen Anordnung von Radioteleskopen, sie tragen die Bezeichnung „Kreuz des Nordens“. Dazu kommt eine 32 Meter große Parabolantenne. Wer am 8. Oktober den Mond beobachten möchte, muss natürlich nicht frühmorgens aufstehen. Bei der Internationalen Nacht der Mondbeobachtung steht der Mond nach Sonnenuntergang hoch und hell als Halbmond am Abendhimmel.