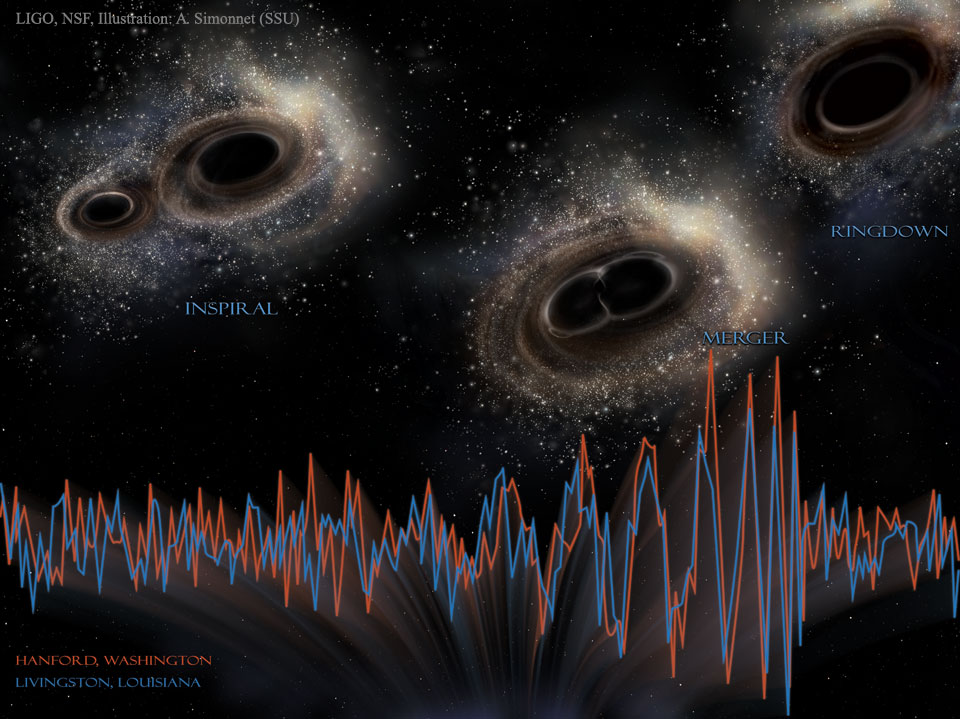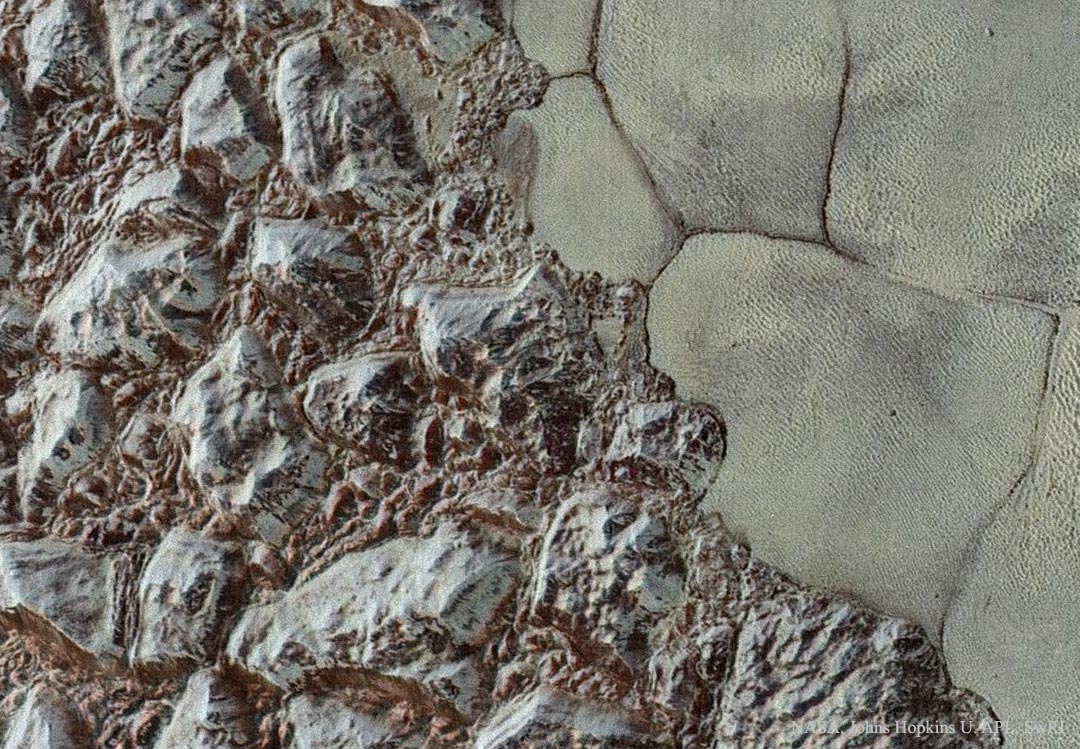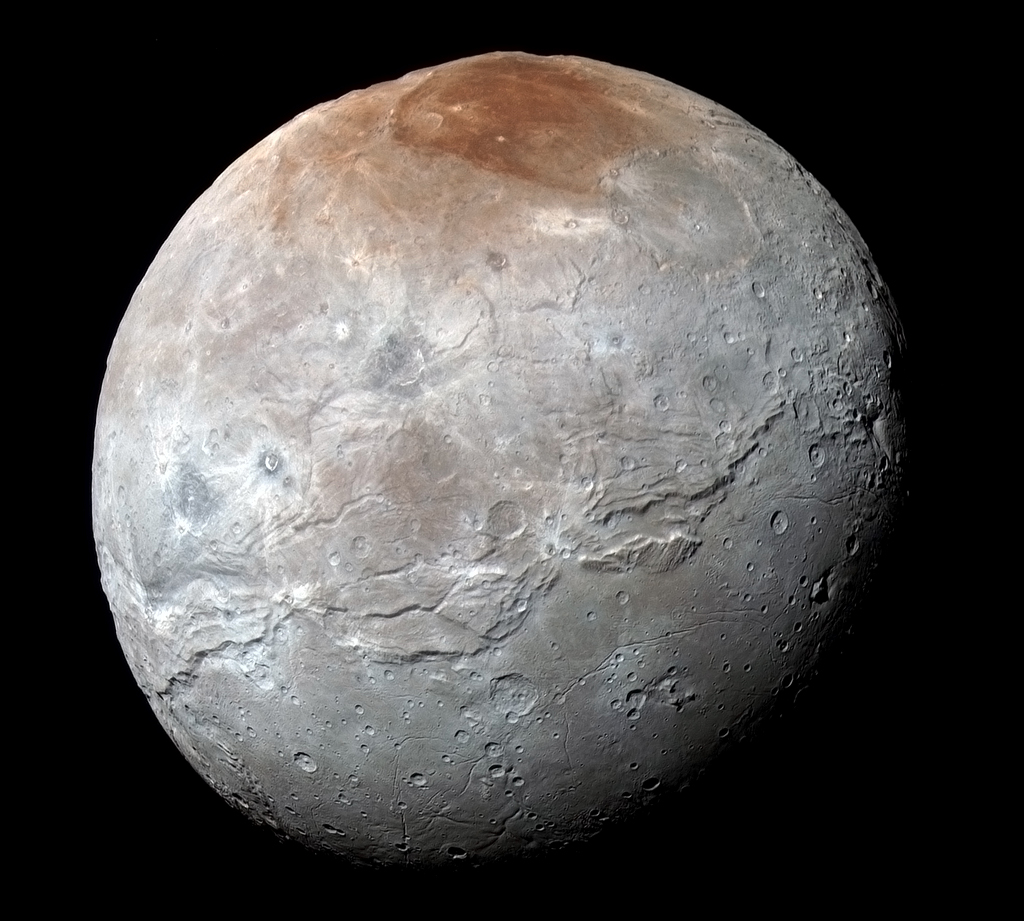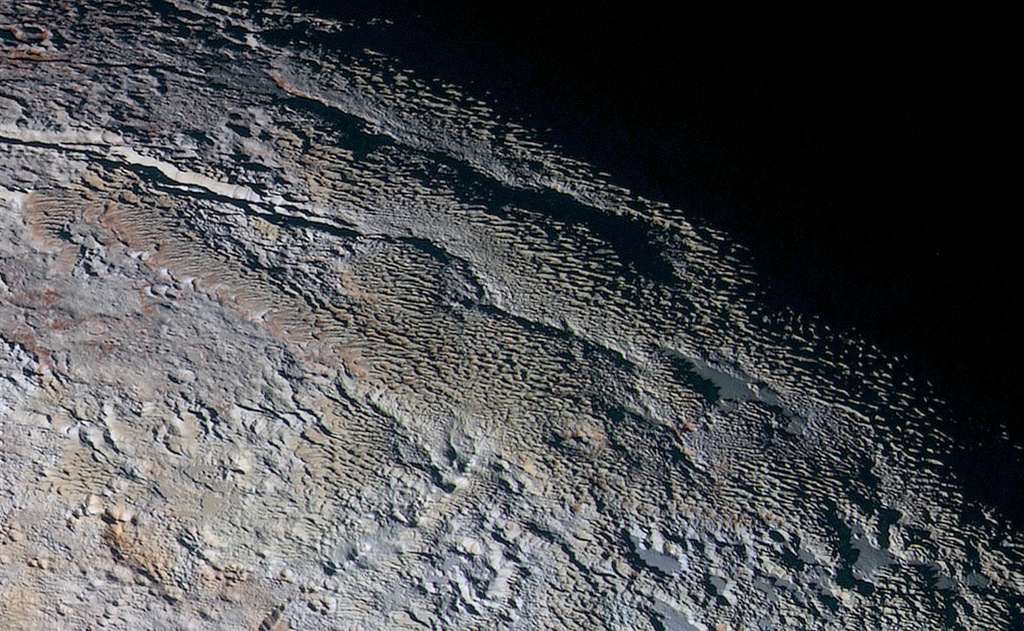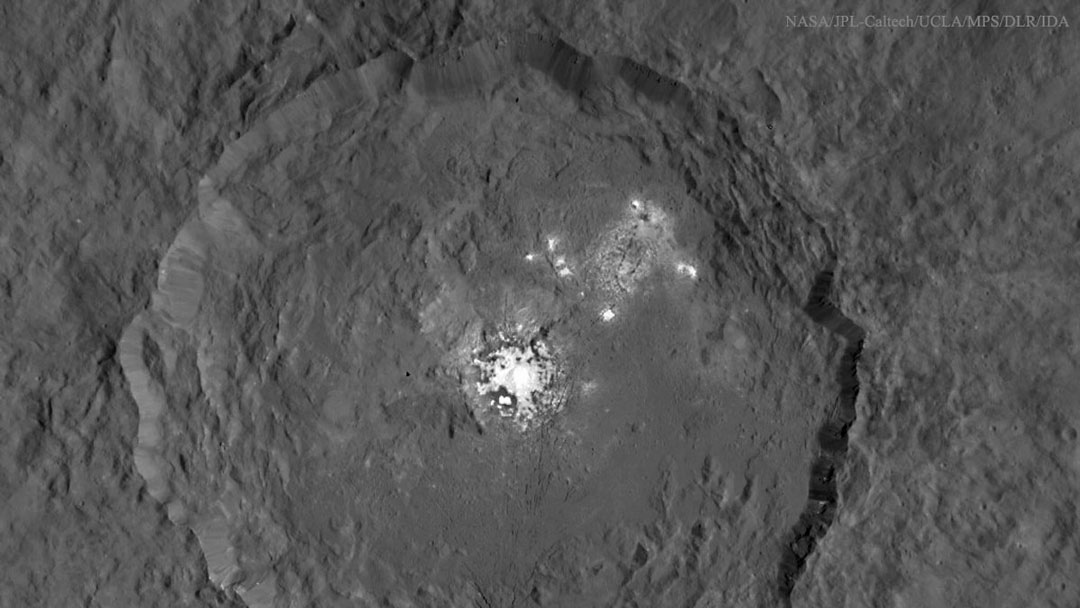Bildcredit: Classical Numismatic Group, Inc., Wikimedia
Der heutige 29. Februar ist ein Schalttag. Das ist ein relativ seltenes Ereignis. Im Jahre 46 v. Chr. schuf Julius Caesar ein Kalendersystem, das alle vier Jahre einen Schalttag hinzufügt. Er folgte damit dem Rat des Astronomen Sosigenes aus Alexandria. Mit dem Schalttag glich er aus, dass ein Erdenjahr etwas länger als 365 Tage dauert.
Heute würde man sagen: Die Zeit, die die Erde für eine Runde um die Sonne braucht, ist etwas länger als die Zeit, in der sich die Erde 365 Mal um ihre eigene Achse dreht (bezogen auf die Sonne. Genau genommen dauert es zirka 365,24219 Rotationen). Wären alle Kalenderjahre 365 Tage lang, dann würden sie alle vier Jahre um etwa einen Tag vom tatsächlichen Jahr abweichen.
Caesar ist hier auf einer Münze dargestellt, die auf seinen Erlass hin geprägt wurde. Der Monat Juli wurde posthum nach Julius Caesar benannt. Ohne Schalttage wäre dieser Monat eines Tages auf der Nordhalbkugel im Winter! Weil man aber alle vier Jahre ein Schaltjahr mit einem zusätzlichen Tag einführte, wich das Kalenderjahr viel weniger stark ab.
Der julianische Kalender wurde bis ins Jahr 1582 verwendet. Dann führte Papst Gregor XIII. eine weitere Detailanpassung ein. Er verfügte, dass Schalttage nicht in Jahren auftreten, die mit „00“ enden, außer wenn sie durch 400 teilbar sind. Das gregorianische Kalendersystem ist heute weit verbreitet.