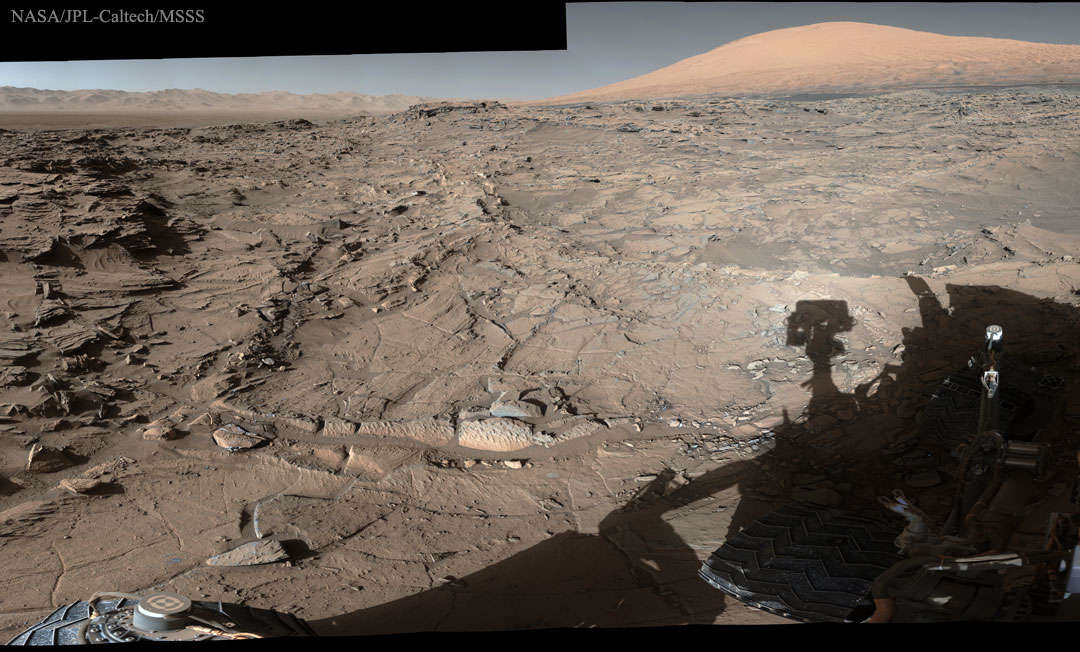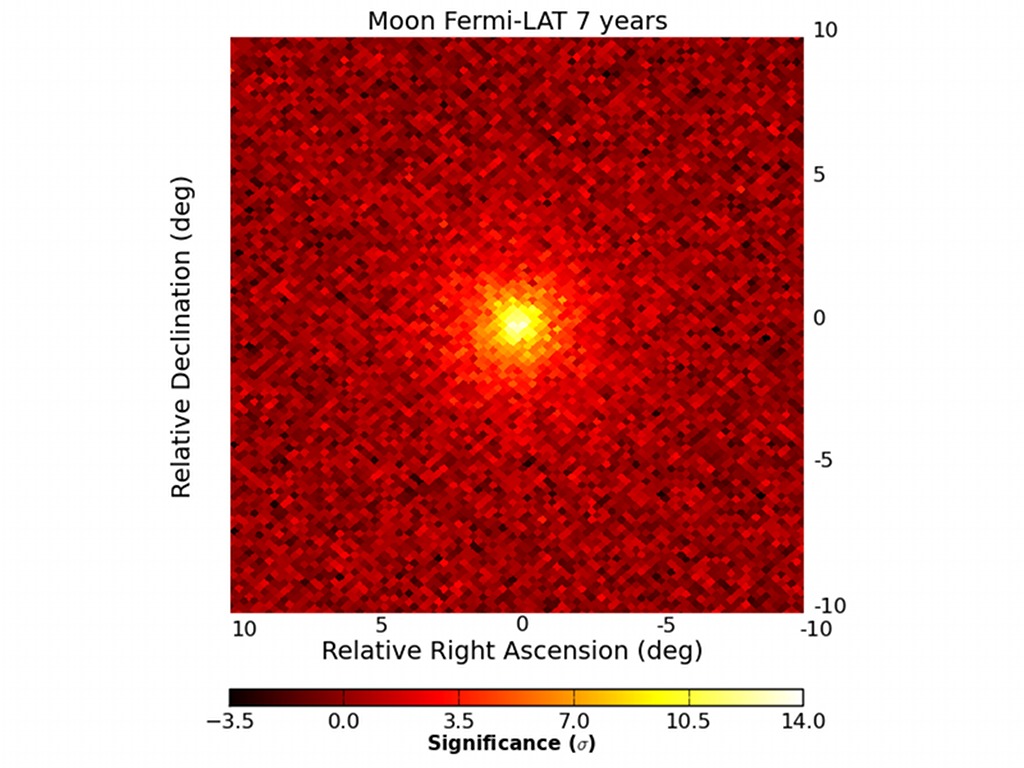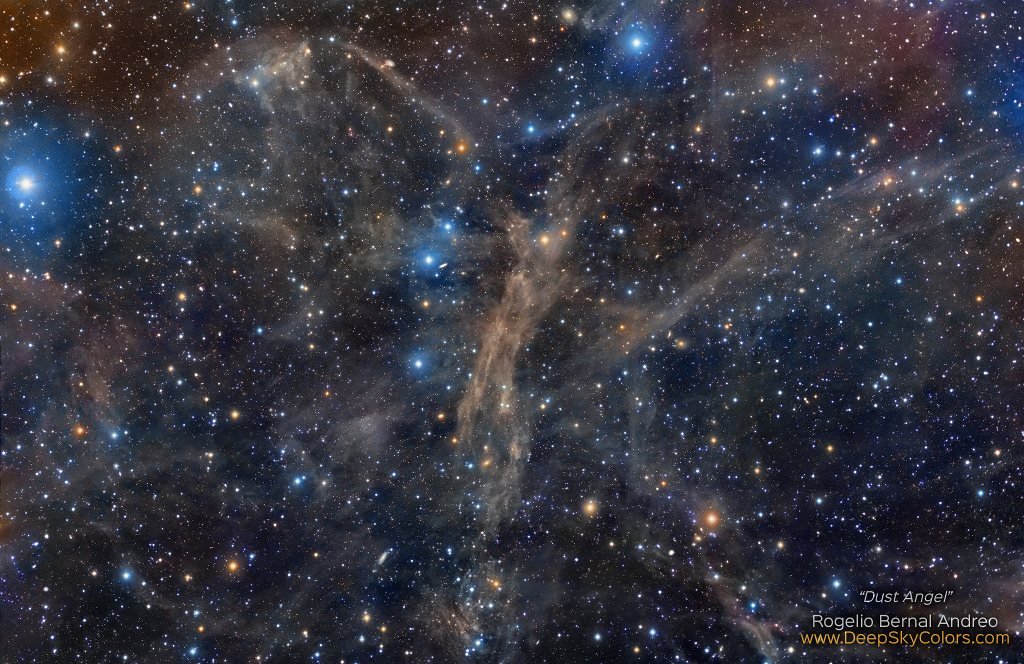Bildcredit und Bildrechte: Göran Strand
Diese prachtvolle Schau mit Polarlichtern leuchtete hell und grün und reichte über den ganzen Himmel. Sie wurde letzten Monat in der Nähe von Östersund in Schweden fotografiert. Sechs Bildfelder wurden zu diesem Panorama kombiniert, es ist fast 180 Grad breit. Das Polarlicht fällt besonders durch seine ausladende Bogenform und die klare Begrenzung auf.
Vorne ist der Storsjön zu sehen. Weit im Hintergrund leuchten vertraute Sternbilder und der Polarstern. Sie sind hinter dem Polarlicht sichtbar. Gleichzeitig meidet das Nordlicht scheinbar den Mond, er scheint links unten.
Das Polarlicht schimmerte einen Tag nach der Öffnung eines großen Loches in der Korona der Sonne, durch das besonders energiereiche Teilchen ins Sonnensystem strömten. Die grüne Farbe des Nordlichtes stammt von Sauerstoffatomen, die mit Elektronen in der Umgebung hoch oben in der Erdatmosphäre rekombinieren.