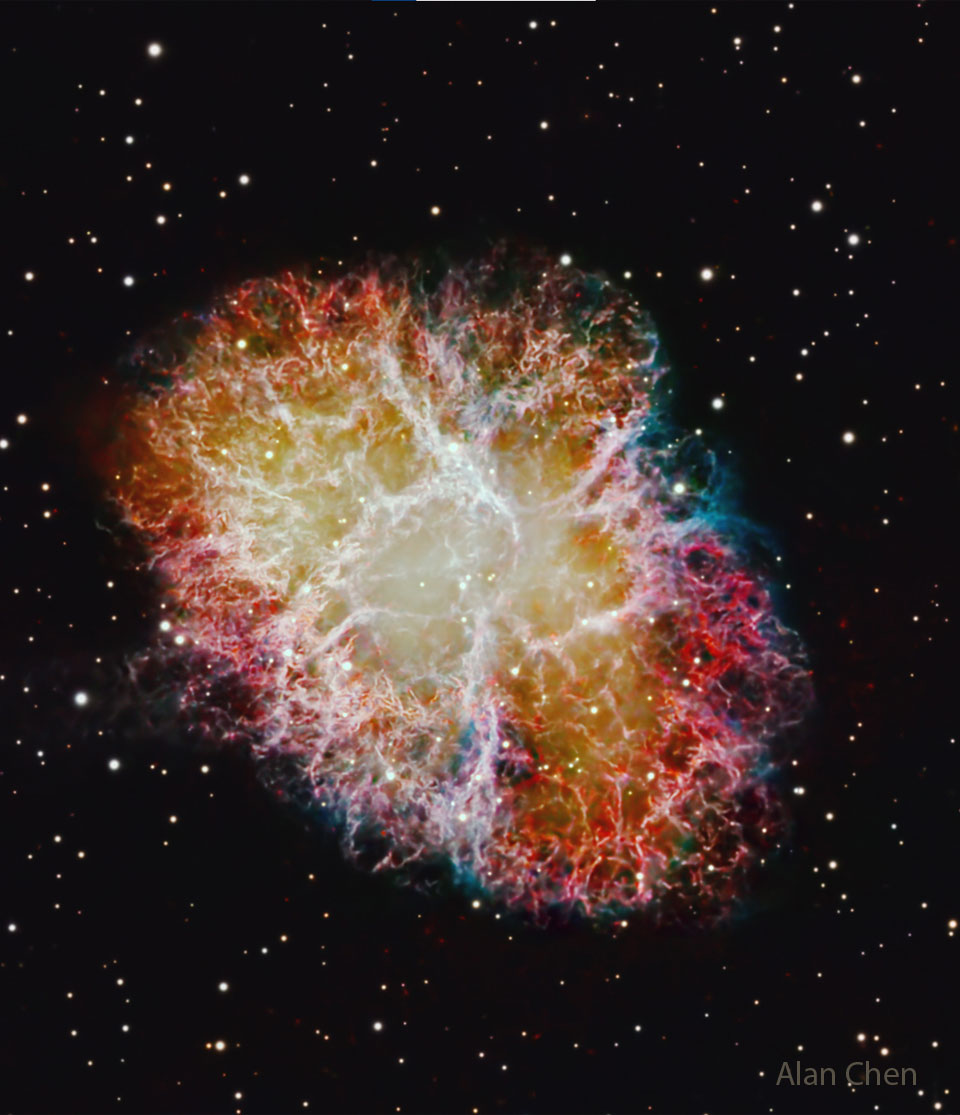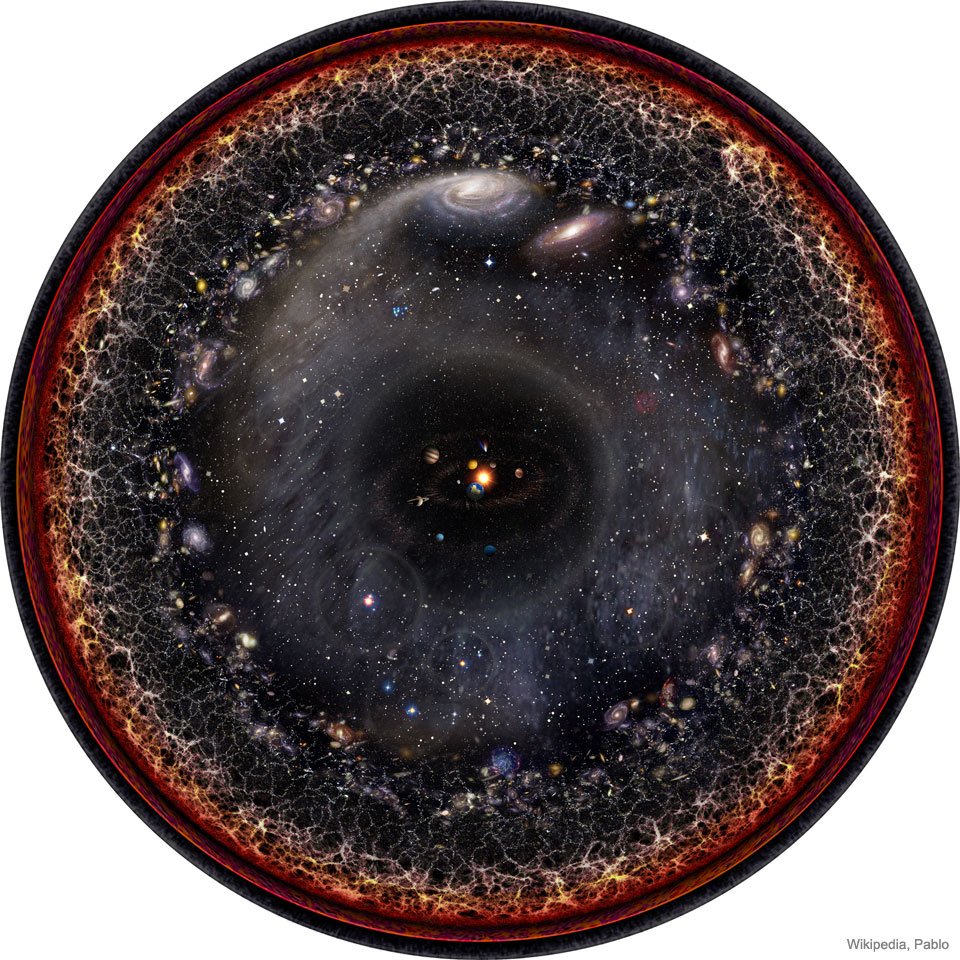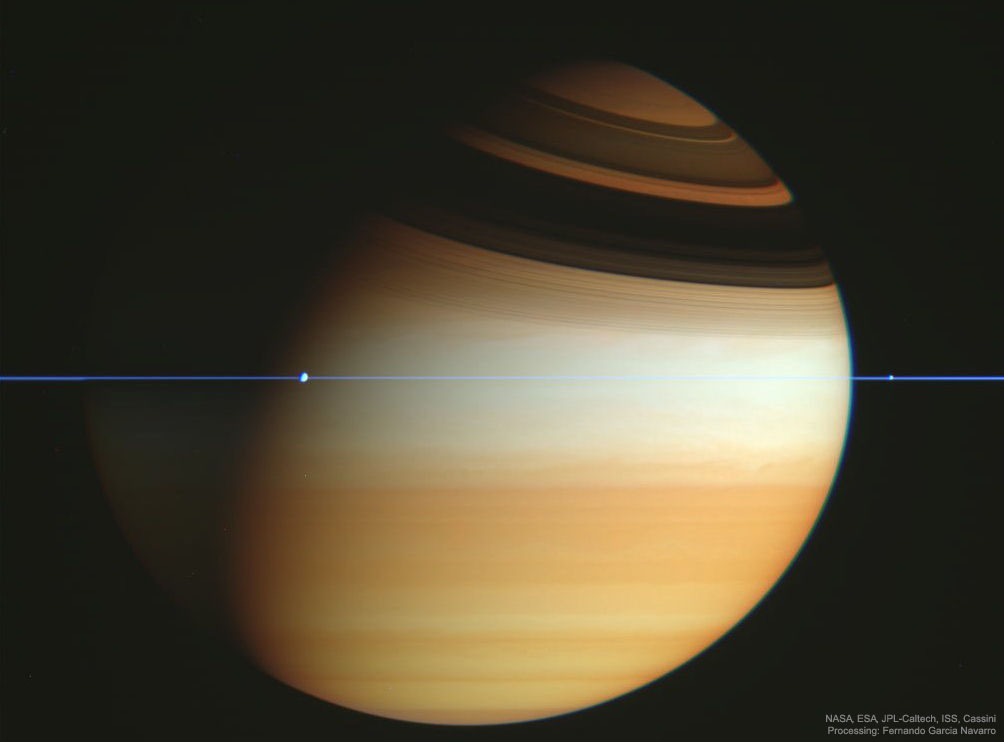Bildcredit und Bildrechte: Roi Levi
Dank des Maximums des 25. Sonnenzyklus war das Jahr 2025 großartig für Nordlichter (und Südlichter). Die starke Aktivität der Sonne dürfte im Jahr 2026 noch andauern. Genießt dieses spektakuläre Polarlicht, während ihr den Beginn des neuen Jahrs feiert. Das Nordlicht erfüllte den sternenbedeckten Nachthimmel über dem Kirkjufell in Island.
Die eindrucksvolle Polarlicht-Korona strahlte während eines starken geomagnetischen Sturms. Er entstand im März 2025 durch intensive Sonnenaktivität während der Tagundnachtgleiche. Wenn ihr direkt von unten in die Schleier eines Polarlichts blickt, könnt ihr so eine Korona sehen. Das Panorama der nordischen Landschaft und des eindrucksvollen Schauspiels am Himmel besteht aus 21 Einzelbildern.