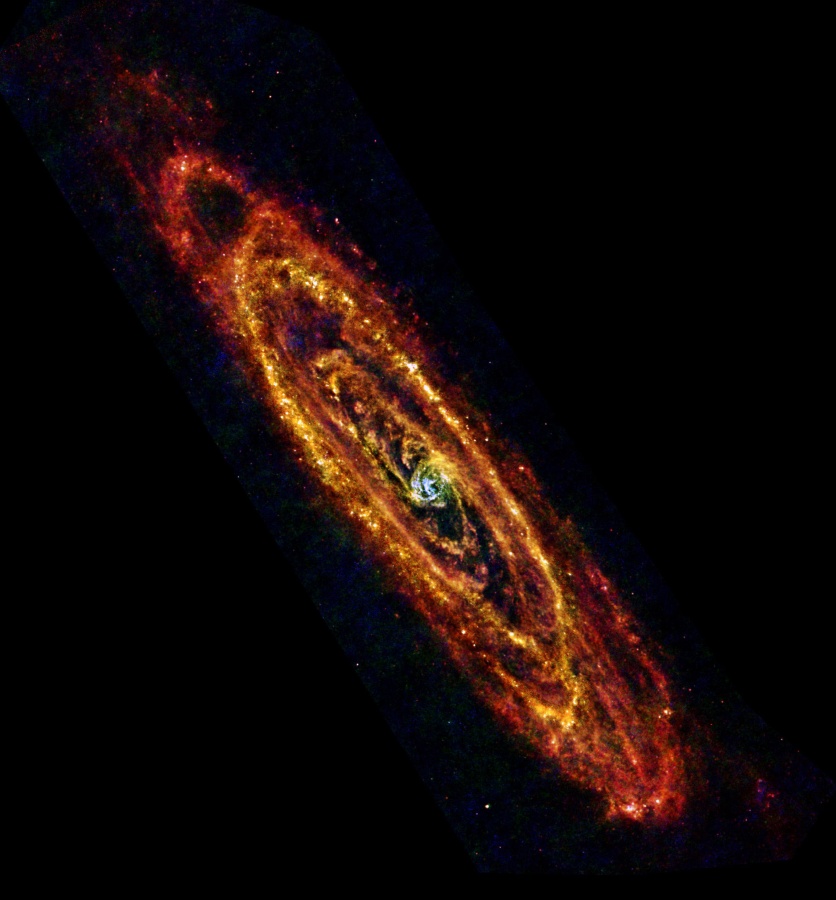Bildcredit: NASA, ESA und das Hubble-Vermächtnisteam
Diese ästhetische Nahaufnahme zeigt kosmische Wolken, die von Sternenwinden geformt werden. Der Stern LL Orionis wechselwirkt mit dem Orionnebelfluss. Der veränderliche Stern LL Orionis befindet sich in Orions Sternbildungsstätte. Er ist selbst noch in seinen Entstehungsjahren und erzeugt einen Wind, der energiereicher ist als der Wind unserer Sonne, die im mittleren Alter ist.
Wo der schnelle Sternwind auf Gas trifft, das sich langsam bewegt, entsteht eine Stoßfront, ähnlich der Bugwelle eines Bootes, das durch Wasser treibt, oder die Stoßwelle eines Flugzeugs, das schneller fliegt als der Schall.
Die kleine gebogene zierliche Struktur links über der Mitte ist die kosmische Stoßwelle von LL Ori. Sie hat einen Durchmesser von etwa einem halben Lichtjahr. Das langsamere Gas fließt vom heißen zentralen Sternhaufen im Orionnebel weg. Dieser Sternhaufen ist das Trapez. Es liegt außerhalb der linken oberen Bildecke.
In drei Dimensionen hat die Stoßfront, die sich um LL Ori biegt, die Form einer Schale. Sie erscheint am hellsten, wenn man ihren „Boden“ entlangblickt. Die Aufnahme ist Teil eines großen Mosaikbildes der komplexen Sternbildungsregion in Orion. Sie enthält eine Vielzahl fließender Formen, die mit Sternbildung einhergehen.