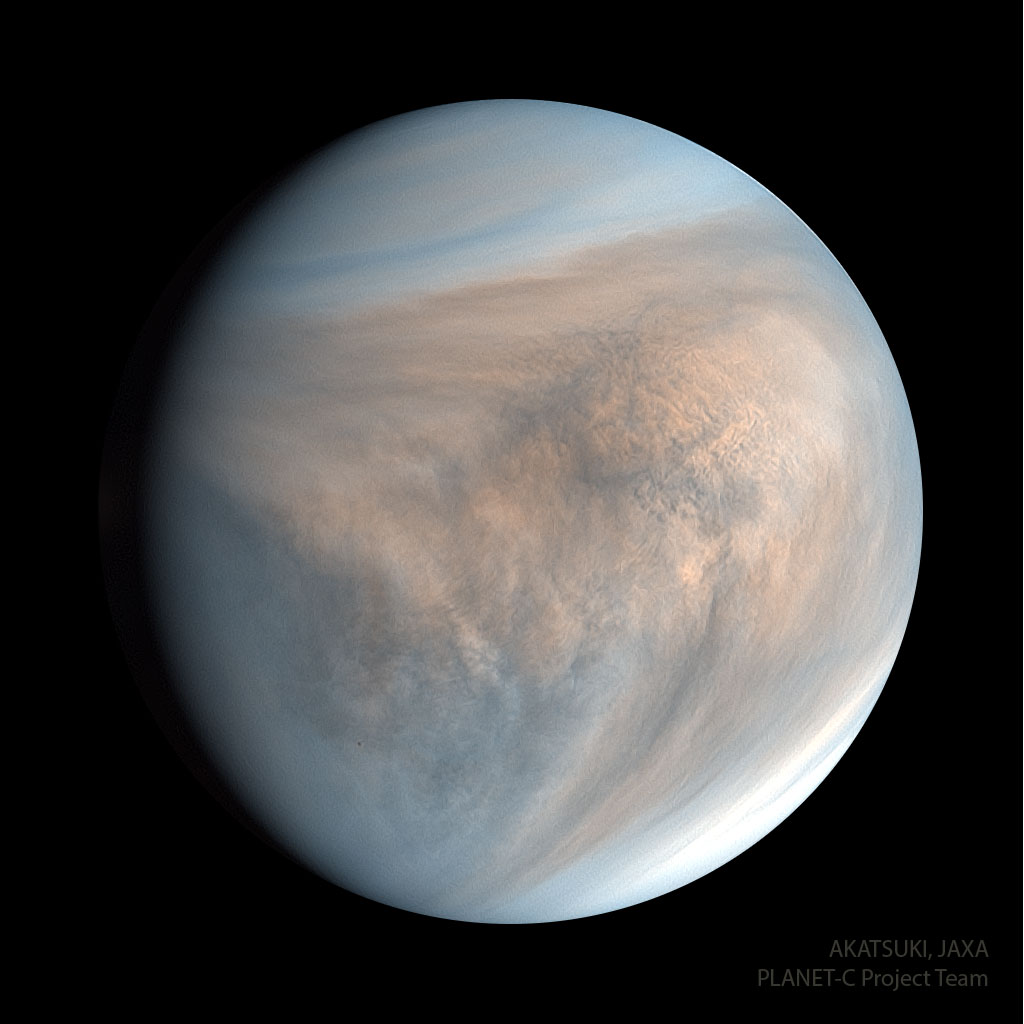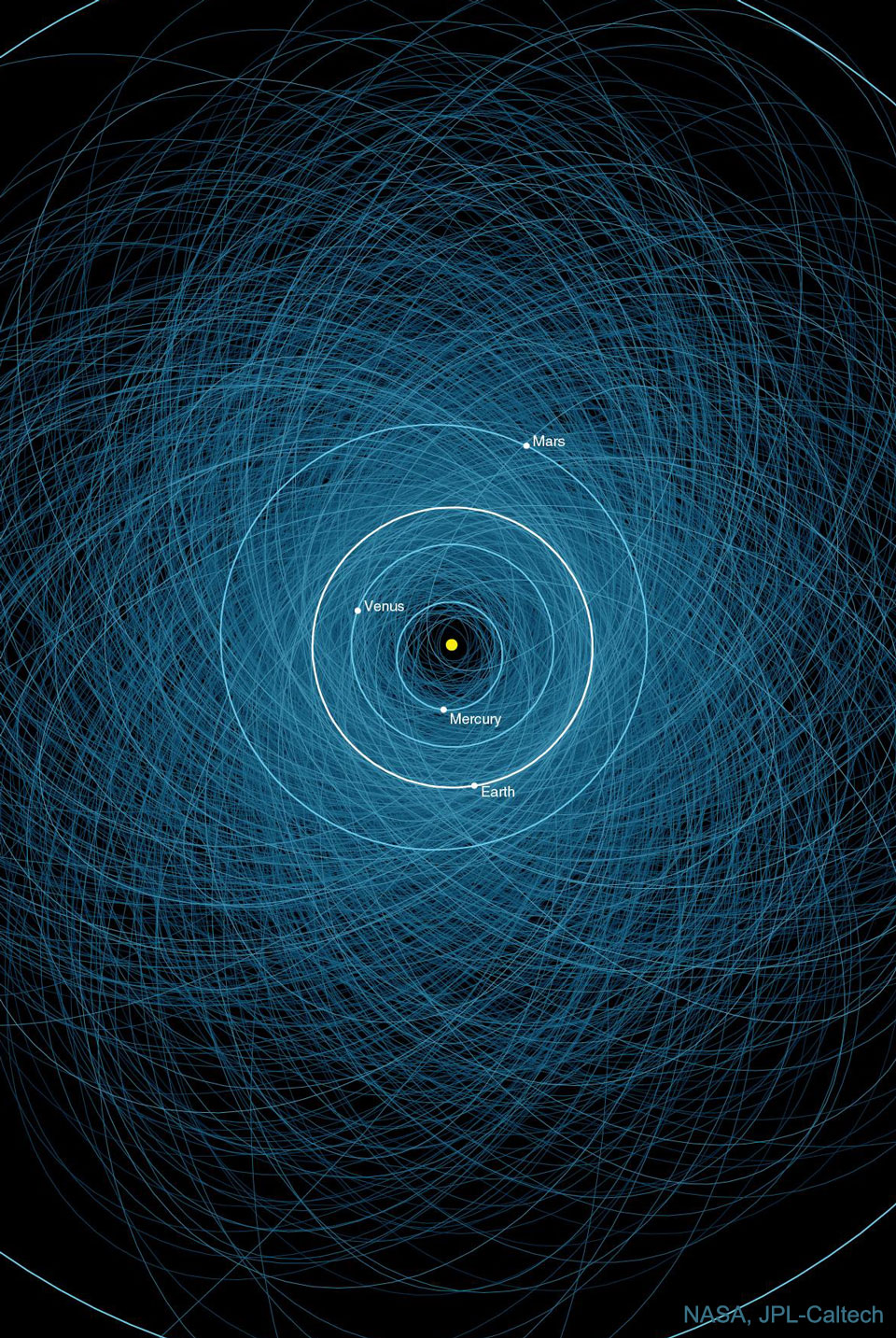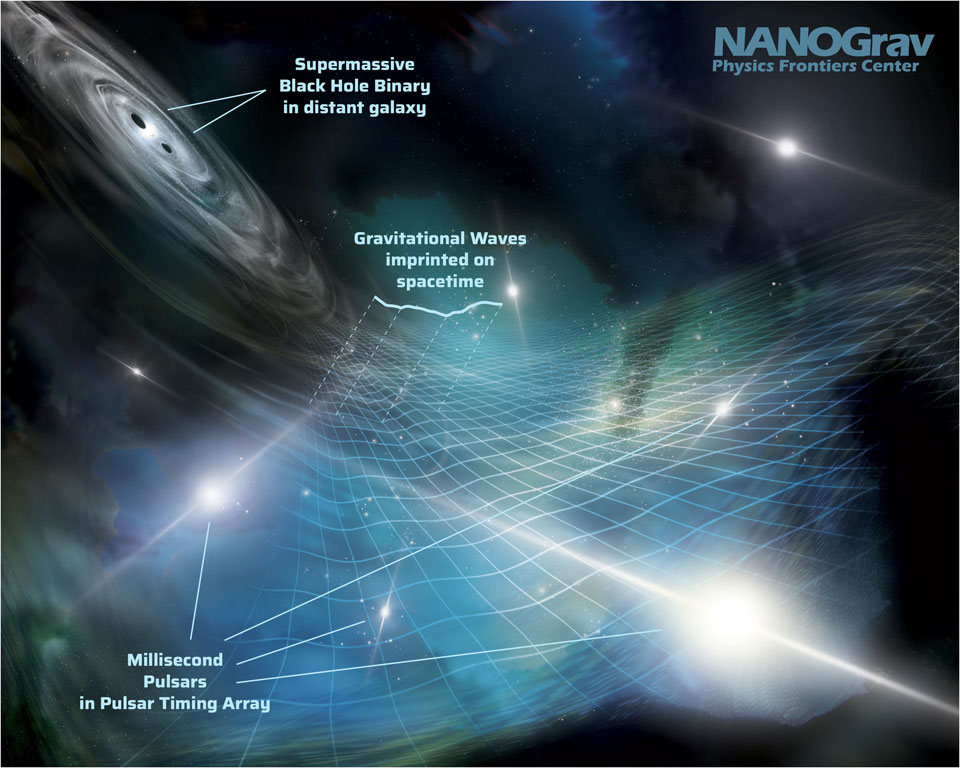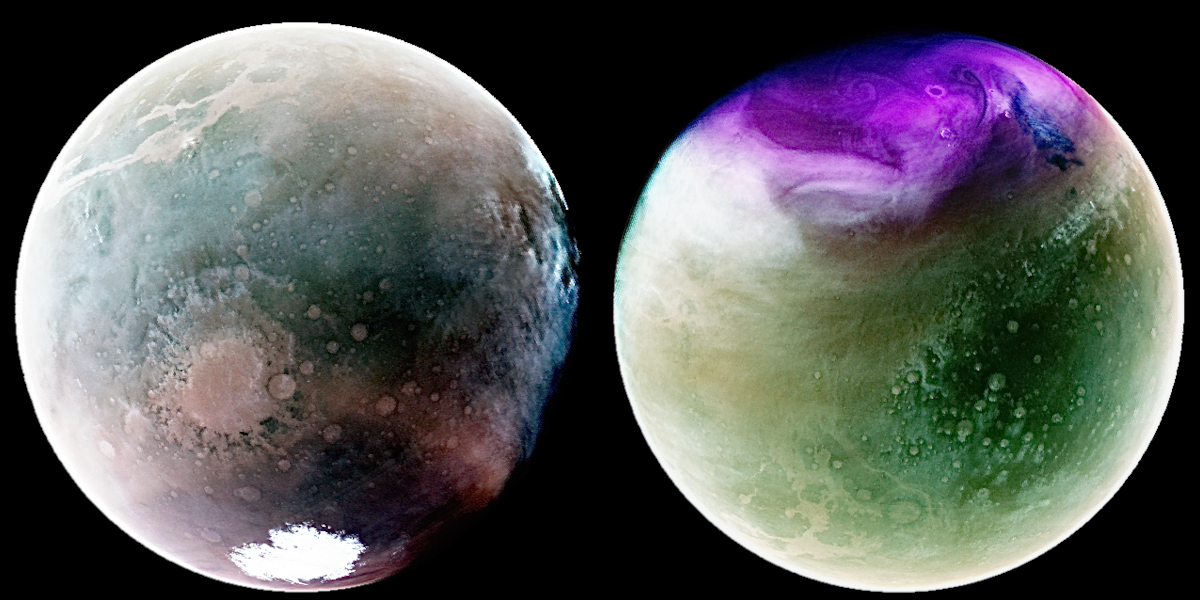Bildcredit und Bildrechte: Cari Letelier
Es schien, als wäre der Himmel explodiert. Die ursprüngliche Idee war, ein Polarlicht über einem Wasserfall zu fotografieren. Doch nach stundenlangem Warten unter den dichten Wolken schwand die Hoffnung. Einige gingen fort.
Dann verzogen sich plötzlich die Wolken. Auf einmal waren die Teilchen eines großen magnetischen Sonnensturms zu sehen, die mit voller Wucht auf die obere Erdatmosphäre trafen. Der Nachthimmel füllte sich mit Farben und der Bewegung eines lebhaften Polarlichts. Mit Mühe wurde die Kamera im starken irdischen Wind stabilisiert. So entstanden 34 Aufnahmen, aus denen dieses Bild kombiniert wurde.
Das Ergebnisbild zeigt den fotogenen Wasserfall Goðafoss im Norden von Island Ende Februar vor einem sehr aktiven Polarlicht. Die Explosion auf der Sonnenoberfläche, bei der die energiereichen Teilchen ausgestoßen wurden, fand einige Tage zuvor statt.
Unsere Sonne zeigt eine beeindruckende Oberflächenaktivität, da sie sich einem Sonnenmaximum nähert. Das lässt hoffen, dass in den nächsten Jahren noch eindrucksvollere Polarlichter am Nord- und Südhimmel der Erde auftreten.