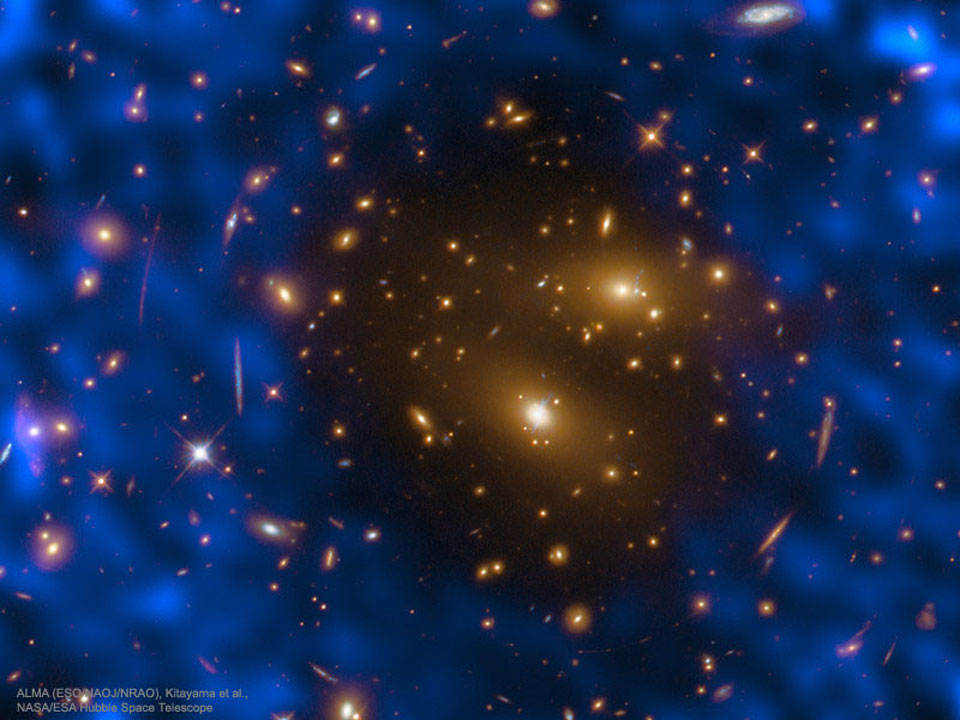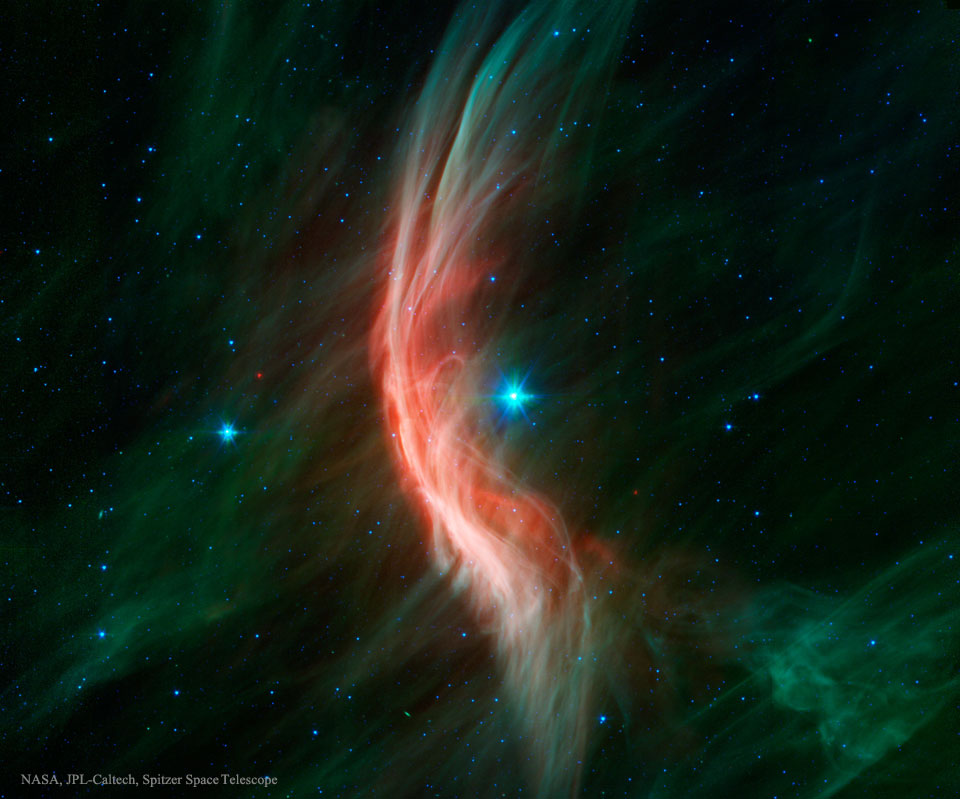Bildcredit und Bildrechte: Majid Ghohroodi
Über dem schönen Panorama wölbt sich der kristallklare Himmel. Am Dach der Welt geht der Bogen des Erdschattens auf. Die reizende Ansicht in der Dämmerung entstand aus acht Einzelbildern. Sie wurden am 6. April bei Sonnenuntergang auf 4000 Metern Seehöhe fotografiert.
Über der dunkelgrauen Grenze des Erdschattens liegt der abklingende rosarote Bogen der Gegendämmerung. Er wird auch Venusgürtel genannt und besteht aus rötlichem Sonnenlicht, das zurückgeworfen wird. Es mischt sich mit dem Himmel im Osten, der noch blau ist.
Am zerklüfteten Horizont ragt in der Mitte der weit entfernte, riesige scharfe Gipfel des Damāwand im verschneiten Elbursgebirge auf. Damāwand ist eine Gestalt der persischen Mythologie und Literatur, aber auch ein Stratovulkan, der 5610 Meter über Meereshöhe aufragt. Er ist der höchste Gipfel im Iran und im Nahen Osten.