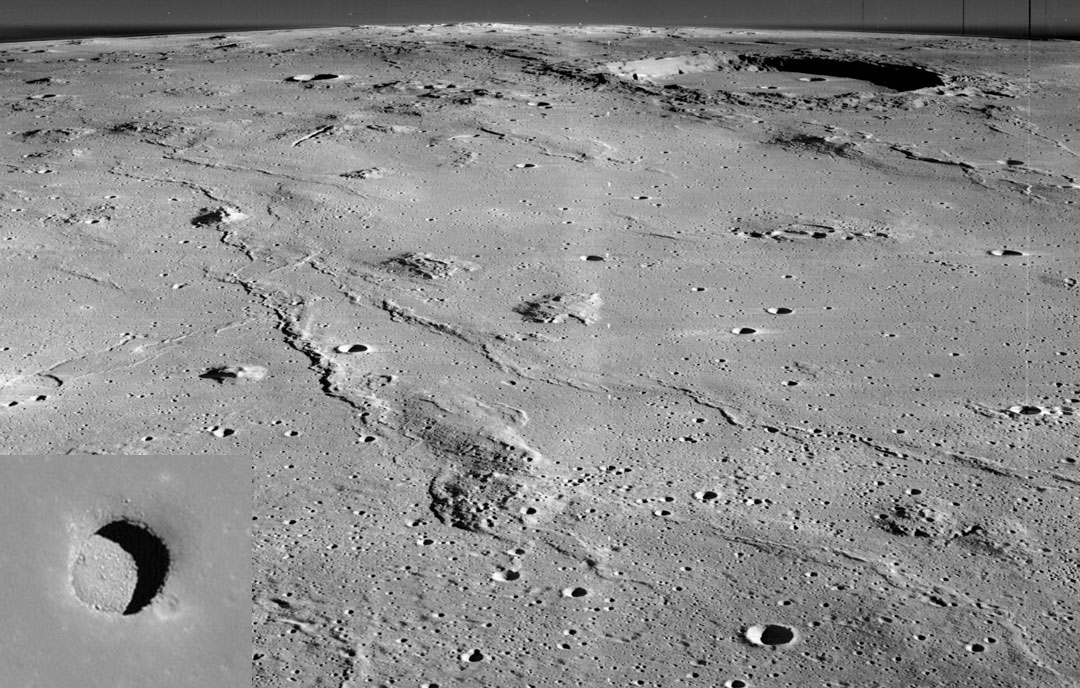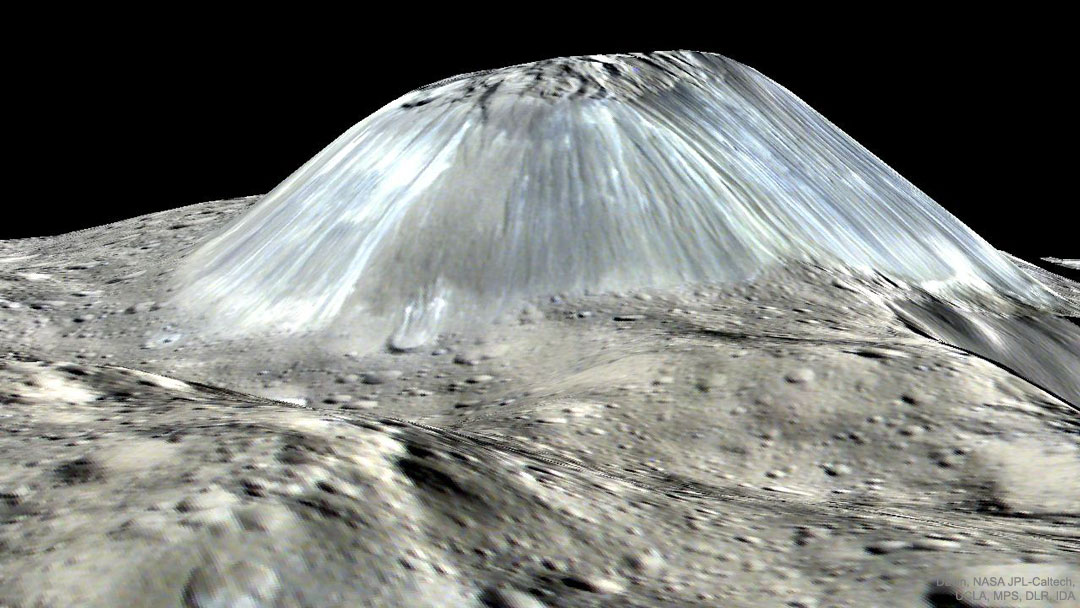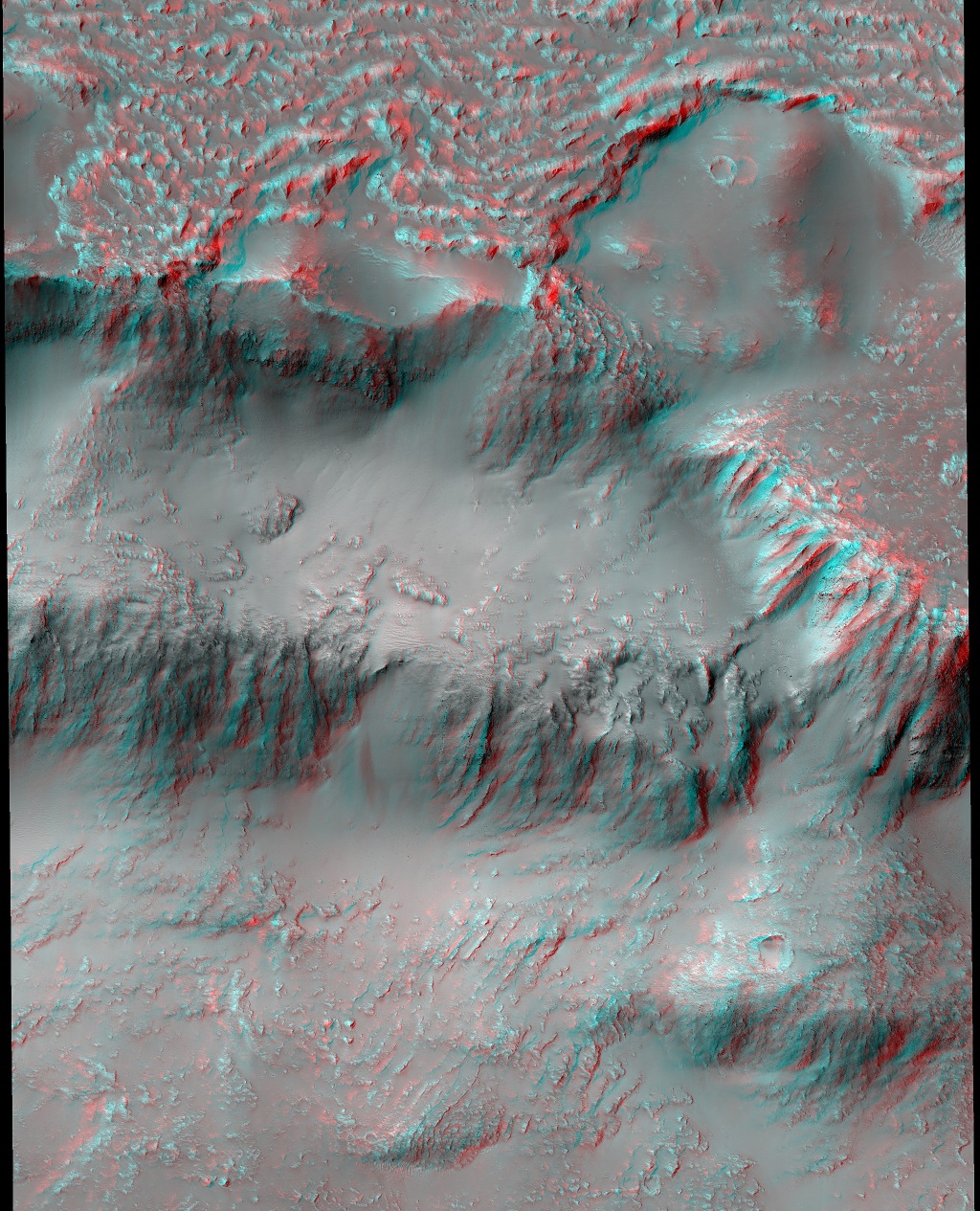Bildcredit und Bildrechte: Lu Shupei
Aus dem Sternbild Orion schossen Meteore. Das war zu erwarten, denn im Oktober ist die Zeit des Sternschnuppenstroms der Orioniden. Letztes Wochenende landeten hier mehr als ein Dutzend Meteore auf Aufnahmen, die nacheinander entstanden. Das Bild wurde bei der Wulanhada-Vulkangruppe fotografiert. Die Vulkane befinden sich in China in der Inneren Mongolei. Die vielen Meteorspuren kann man mit einer kleinen Region am Himmel links über dem Gürtel des Orion verbinden. Dort liegt der Radiant.
Die Meteore der Orioniden entstehen aus Stücken, so klein wie ein Sandkorn. Sie brachen vom Kometen Halley bei seinen Reisen ins innere Sonnensystem ab. Komet Halley verursacht zwei bekannte Meteorströme. Der andere ist als Eta-Aquariiden bekannt. Wir beobachten ihn jedes Jahr im Mai. Nächsten Monat zieht der Meteorstrom der Leoniden einige helle Meteorspuren. Er stammt vom Kometen Tempel-Tuttle.