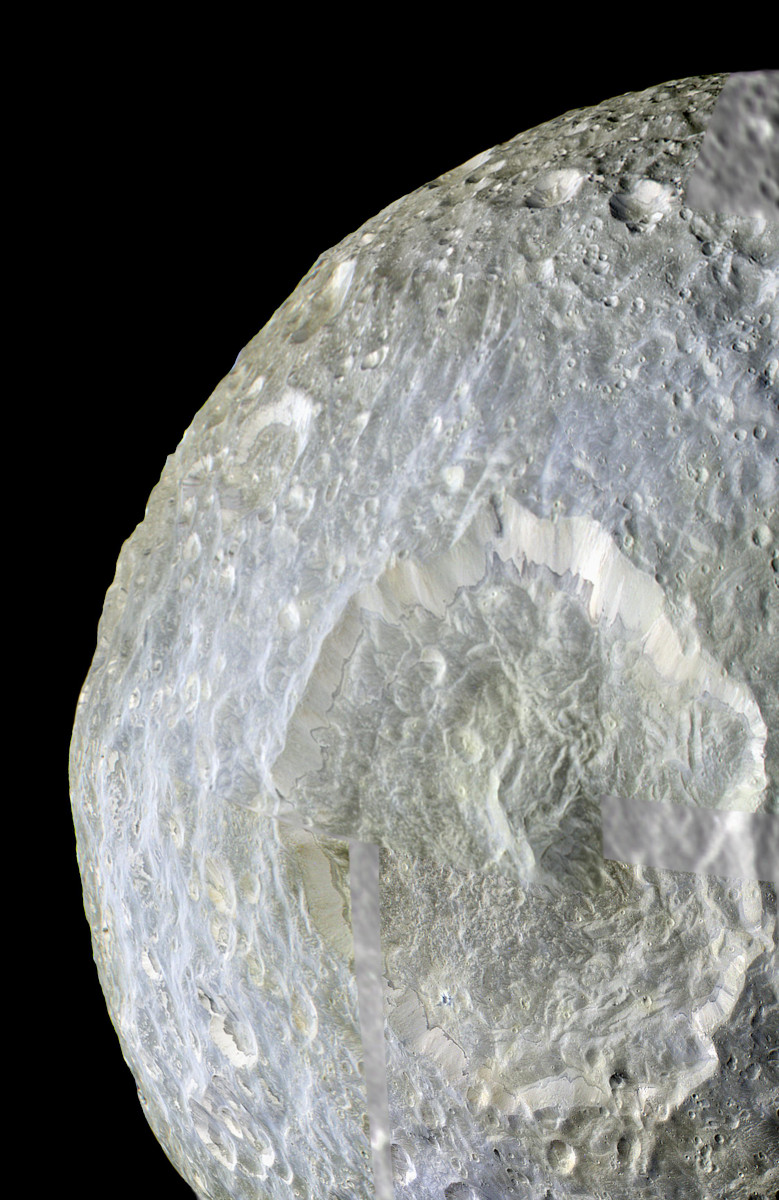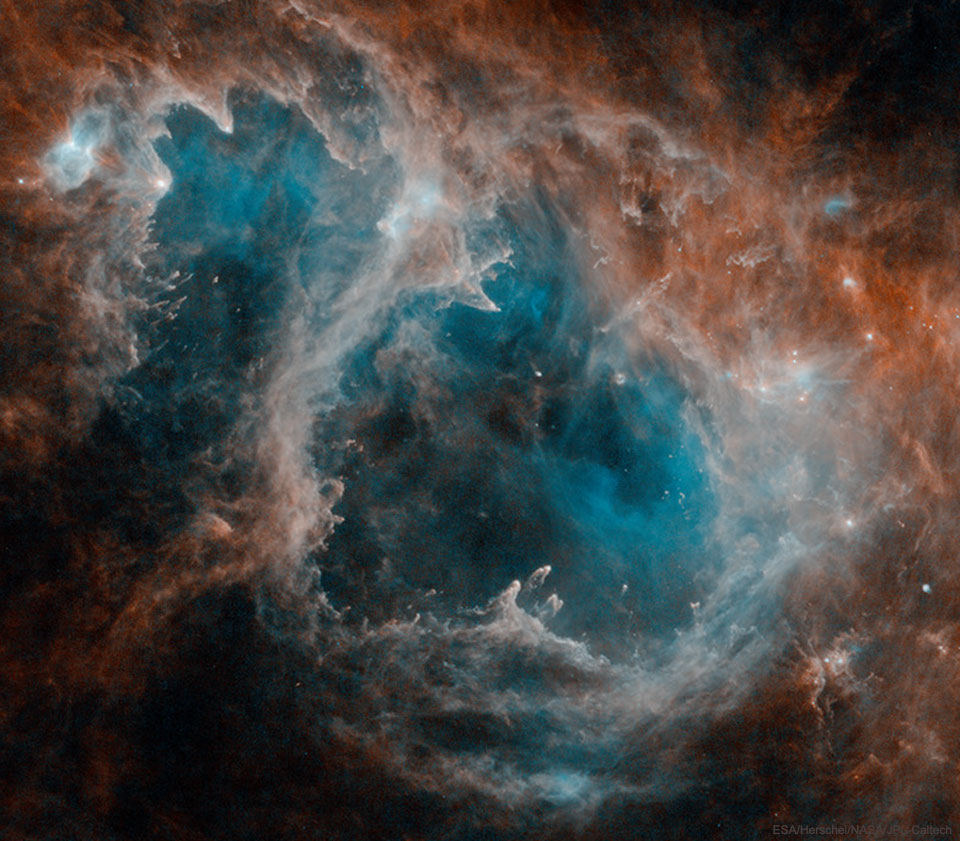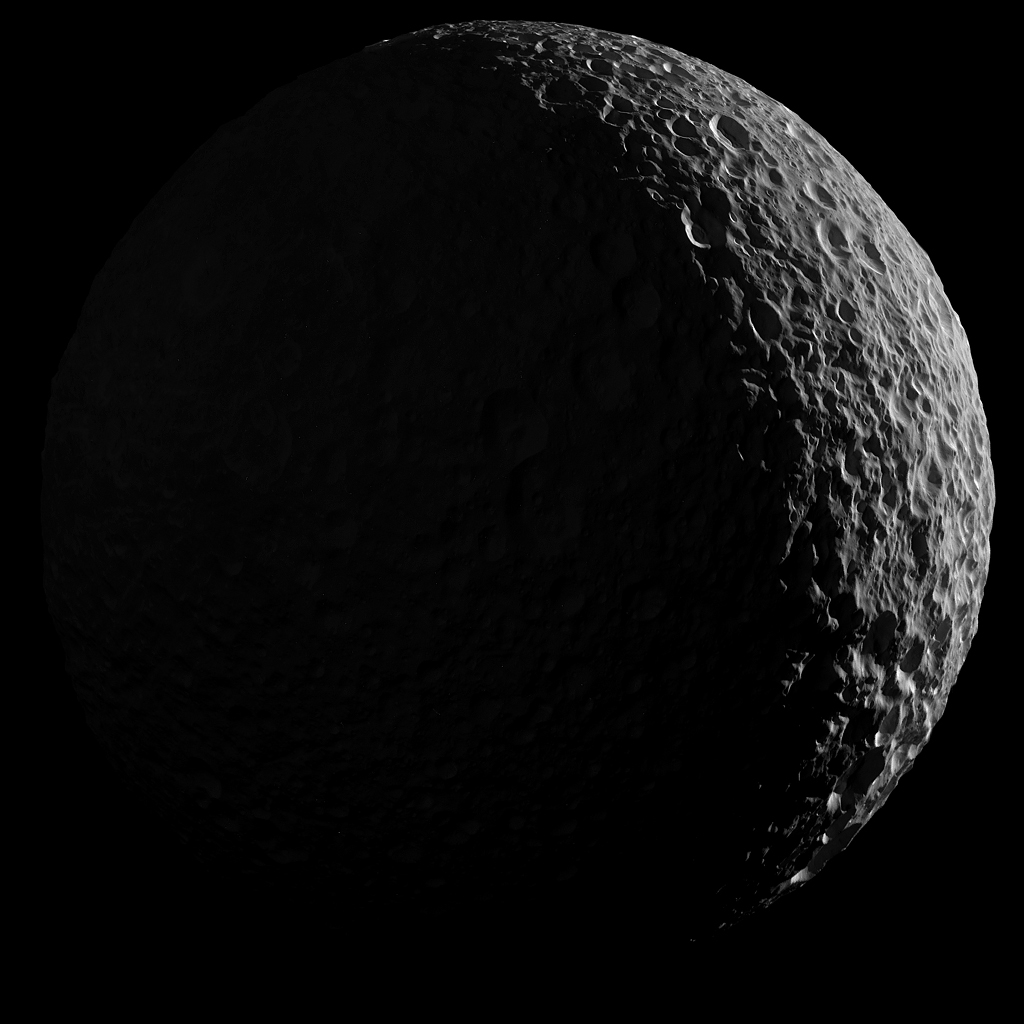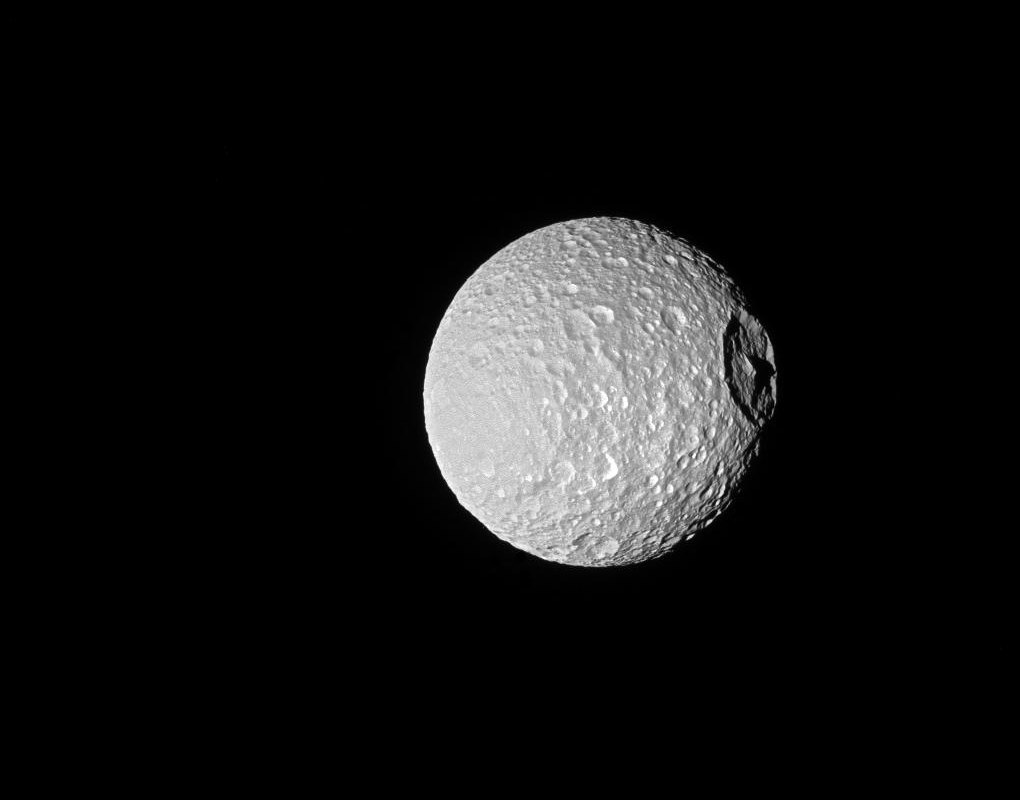Bildcredit und Bildrechte: Steve Crouch
Die glänzende Galaxie NGC 253 ist eine der hellsten sichtbaren Spiralgalaxien und zugleich eine der staubigsten. Manche nennen sie wegen ihres Aussehens in kleineren Teleskopen die Silberdollargalaxie oder einfach die Sculptor-Galaxie wegen ihrer Lage innerhalb der Grenzen des südlichen Sternbilds Sculptor.
Das staubige Inseluniversum wurde 1783 von der Mathematikerin und Astronomin Caroline Herschel entdeckt und liegt nur 10 Millionen Lichtjahre entfernt. Mit einem Durchmesser von etwa 70 000 Lichtjahren ist NGC 253 das größte Mitglied der Sculptor-Galaxiengruppe, die unserer eigenen Lokalen Galaxiengruppe am nächsten ist.
Zusätzlich zu den spiralförmigen Staubbahnen scheinen in diesem farbenfrohen Galaxienporträt Staubfäden aus der galaktischen Scheibe aufzusteigen, die mit jungen Sternhaufen und Sternentstehungsgebieten durchsetzt sind. Der hohe Staubgehalt geht mit einer rasanten Sternentstehung einher, was NGC 253 die Bezeichnung „Starburst-Galaxie“ einbrachte.
NGC 253 ist auch als starke Quelle hochenergetischer Röntgen– und Gammastrahlung bekannt, was wahrscheinlich auf massive schwarze Löcher in der Nähe des Galaxienzentrums zurückzuführen ist.