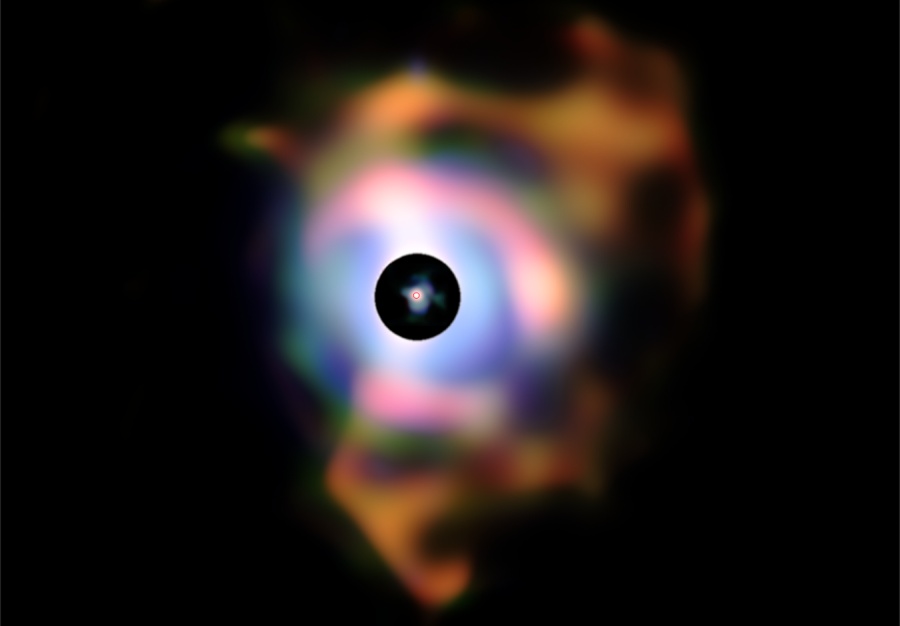Bildcredit und BY-NC-2 Lizenz: Juan Carlos Casado (TWAN, Earth and Stars)
Welche Ikonen am Nachthimmel findet ihr auf diesem detailreichen Bild des nördlichen Winterhimmels? Dazu gehören die Sterne im Gürtel des Orion, der Orionnebel, der Sternhaufen der Plejaden, die hellen Sterne Beteigeuze und Rigel, der Kaliforniennebel, die Barnard-Schleife und Komet Lovejoy mit Koma und Schweif.
Orions Gürtelsterne verlaufen fast senkrecht in der Mittellinie zwischen Horizont und Bildmitte. Beim untersten Gürtelstern findet ihr den rot leuchtenden Flammennebel. Links neben dem Gürtel verläuft der rote Bogen der Barnard-Schleife, gefolgt vom hellen, orange gefärbten Stern Beteigeuze. Rechts daneben schimmert der farbige Orionnebel, gefolgt vom hellen, blauen Stern Rigel.
Oben in der Mitte ist ein blauer Haufen heller Sterne. Es sind die Plejaden. Der rote Nebel links daneben ist der Kaliforniennebel. Über der Bildmitte ist ein heller, orange gefärbter Punkt. Es ist der Stern Aldebaran. Das grüne Objekt mit dem langen Schweif rechts daneben ist Komet C/2014 Q2 (Lovejoy).
Das Bild wurde vor etwa zwei Wochen im spanischen Palau-saverdera fotografiert.