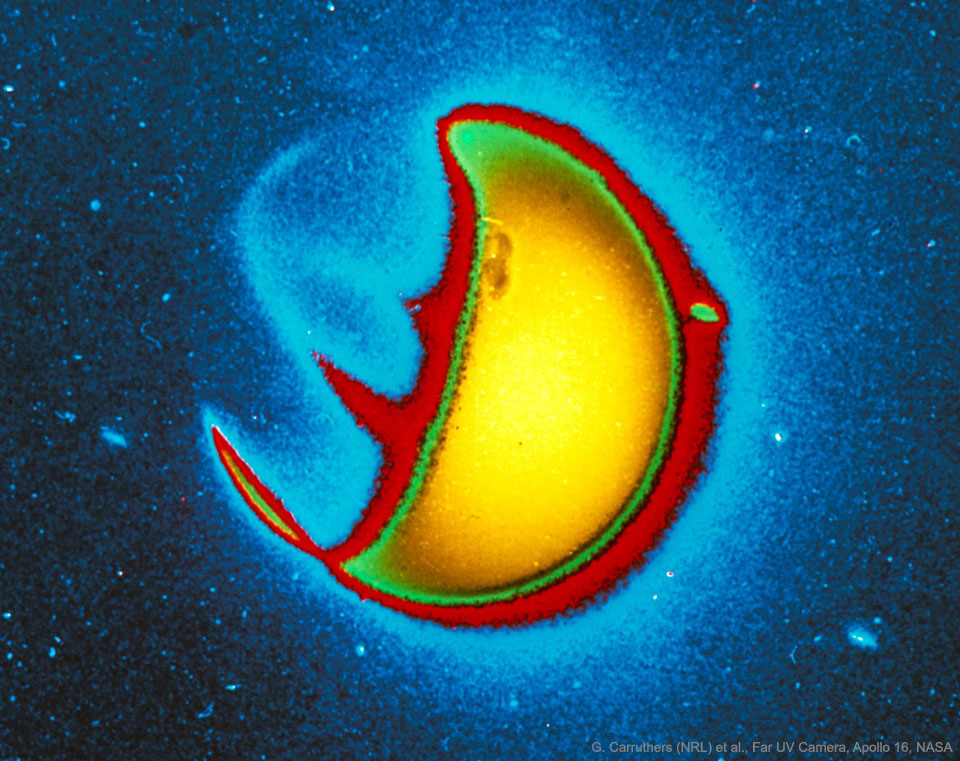Videocredit und –rechte: Brian Haidet – Musikcredit: Space Walk – Silent Partner
Beschreibung: Auf diesem kleinen Planeten ist in 30 Sekunden eine Menge Himmelsbeobachtung untergebracht. Der Zeitrafferfilm wurde als 360-Grad-Vollkugelvideo aufgenommen – natürlich auf dem Planeten Erde am Grande-Pines-Observatorium außerhalb von Pinehurst in North Carolina. Es wurde Anfang September mit einer Kamera und einem kugelförmigen Fischaugenobjektiv gedreht, dazu wurde ein Zeitraum von 24 Stunden mit nach oben gerichteter Kamera und Linse digital mit einer Aufnahme kombiniert, bei der Kamera und Linse nach unten gerichtet waren. Die Ergebnisbilddaten wurden bearbeitet und auf ein flaches Bild projiziert, das auf den Nadir zentriert ist – das ist der Punkt unter der Kamera.
Beobachten Sie, wie Wolken vorbeiziehen, Schatten kriechen, der Himmel von Tag zu Nacht kreist und Sterne um den Horizont wirbeln. Schauen Sie weiter. Im zweiten Abschnitt ist das Zentrum auf den Himmelssüdpol gerichtet, die Rotationsachse des Planeten Erde liegt unter dem Horizont des kleinen Planeten. Die Sterne sind fixiert und der Horizont dreht sich, während der kleine Planet um das Bild rotiert, der halbe Himmel ist Tag und Nacht verborgen.