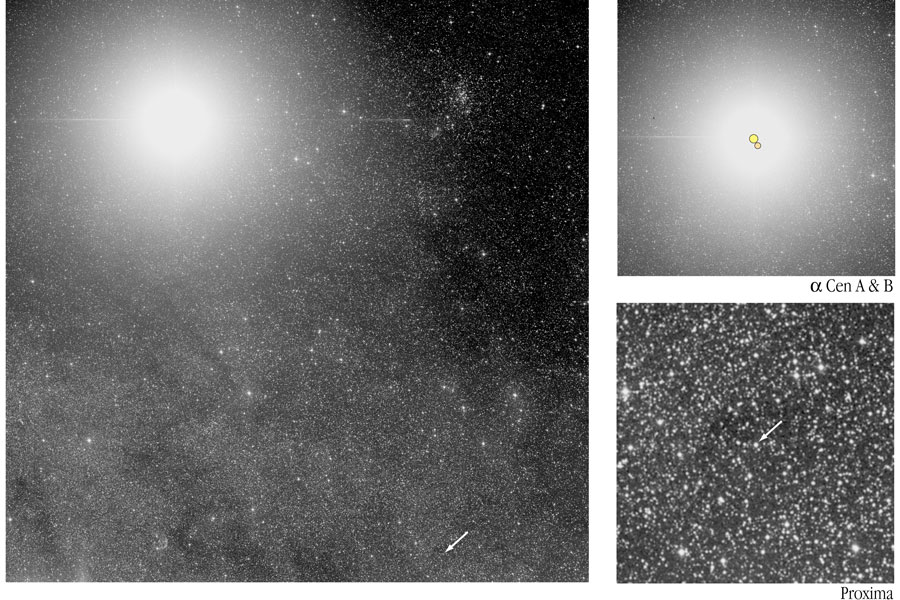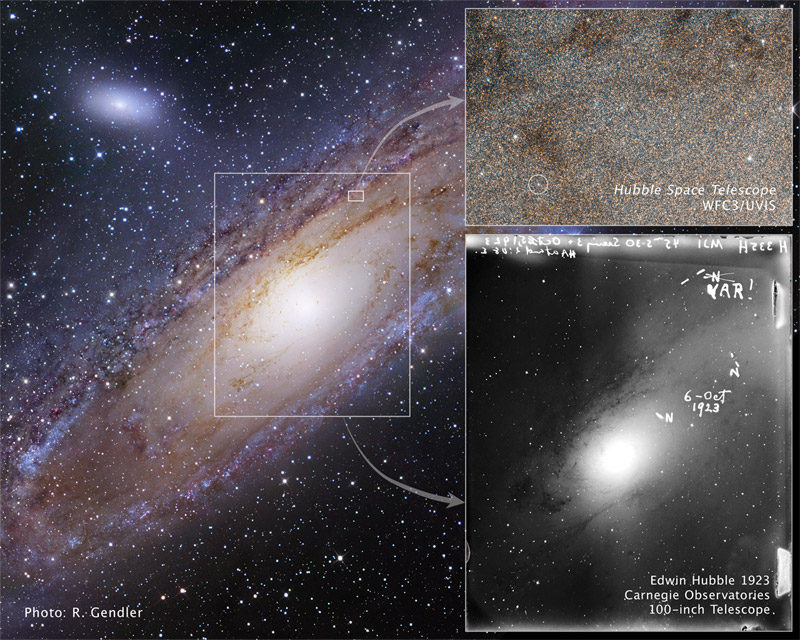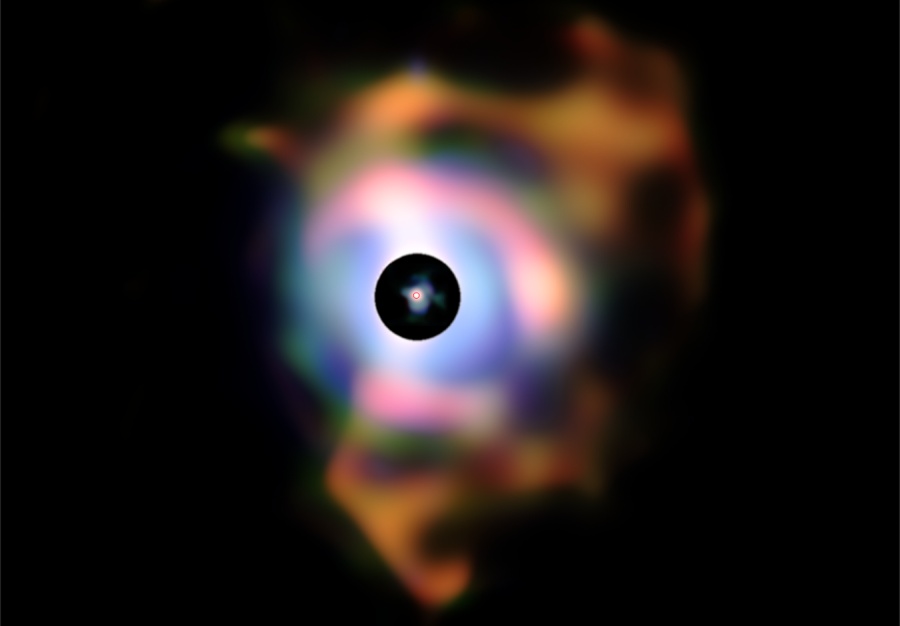Bildcredit und Bildrechte: Juan Carlos Casado (TWAN)
Beschreibung: Warum ist der Schatten dieses Vulkans dreieckig? Der Vulkan Teide hat keine exakte Pyramidenform, wie sein geometrischer Schatten vermuten lässt. Das Phänomen des dreieckigen Schattens beschränkt sich nicht auf den Teide. Auch bei den Gipfeln anderer großer Berge und Vulkane ist es häufig zu beobachten.
Ein Hauptgrund für die seltsame, dunkle Form ist, dass der Beobachter die ganze lange Strecke eines Sonnenuntergangs- oder Sonnenaufgangsschattens bis zum Horizont entlang blickt. Sogar wenn der riesige Vulkan ein perfekter Würfel wäre und der von ihm geworfene Schatten ein langes Rechteck, würde das Rechteck am oberen Ende scheinbar zusammenlaufen, weil der Schatten bis in weite Ferne reicht, wie parallele Eisenbahnschienen. Die Dreiecksform ist ein perspektivisches Phänomen.
Dieses spektakuläre Bild zeigt im Vordergrund den Krater Pico Viejo auf Teneriffa, eine der Kanarischen Inseln von Spanien. Der fast volle Mond steht kurz nach der totalen Mondfinsternis letzten Monat in der Nähe.