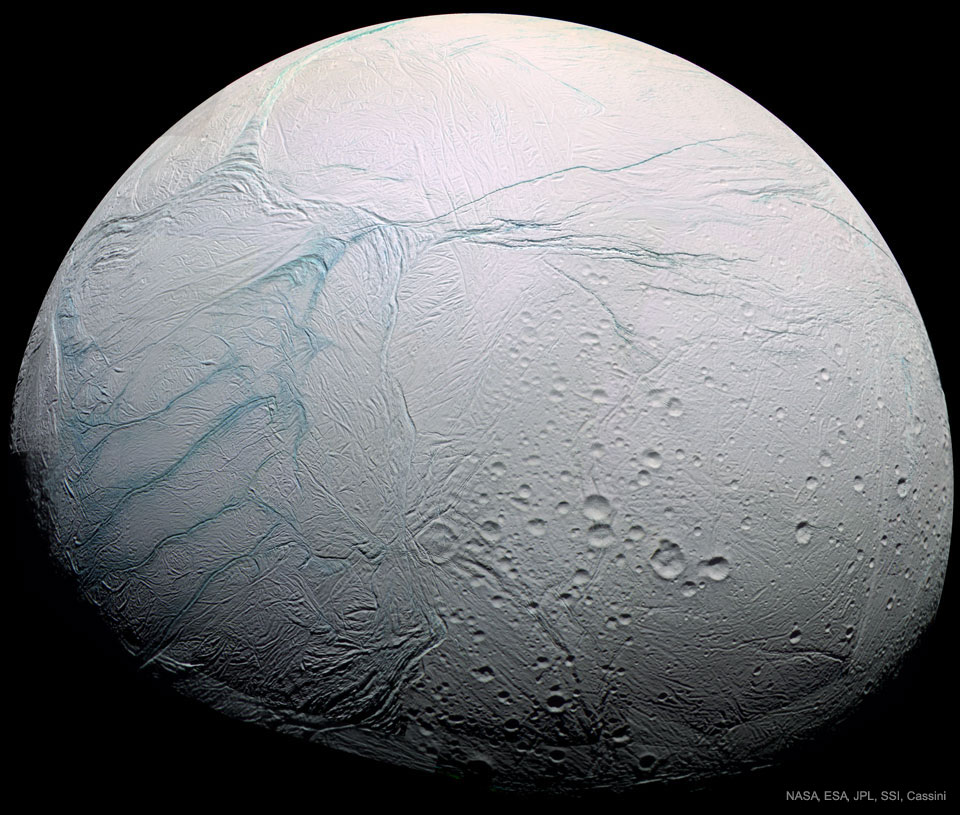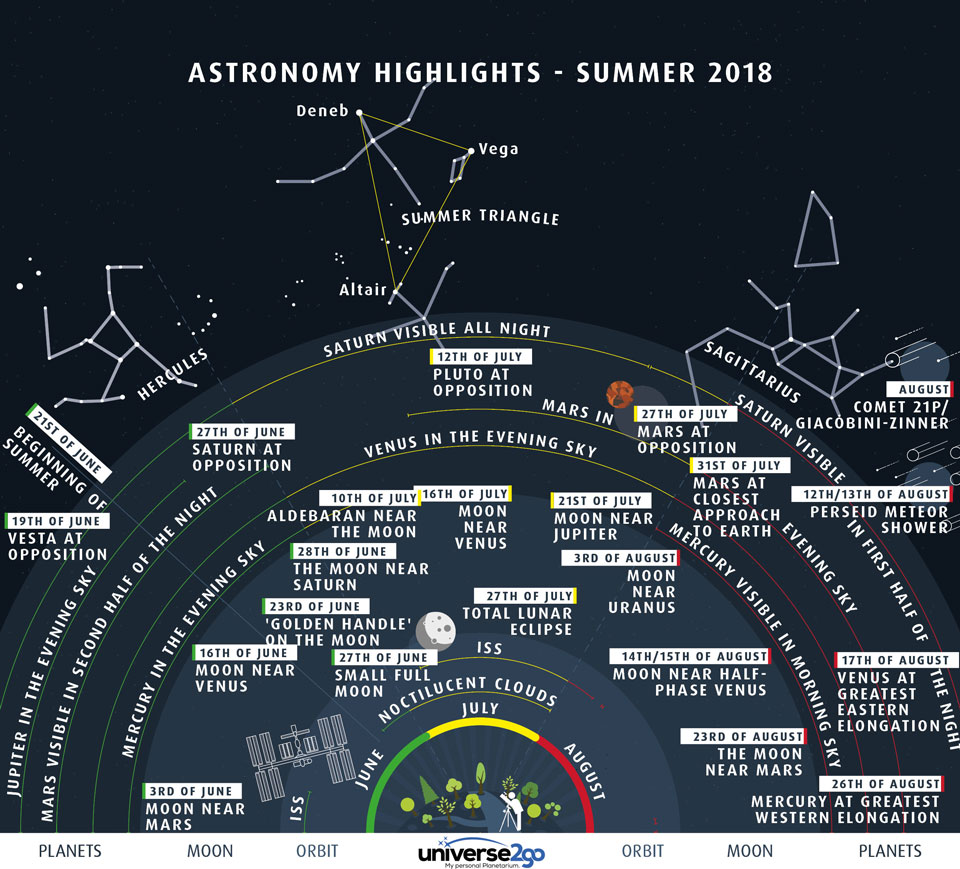Bildcredit und Bildrechte: Michael Seeley
Beschreibung: Wenn Sie letzten Freitag, dem 29. Juni, das Licht der frühen Morgendämmerung an der Cape-Canaveral-Luftwaffenbasis gesehen hätten, dann hätten Sie das rote Leuchten dieser Rakete beobachten können. Die 277 Sekunden belichtete Einzelaufnahme, die auf dem Dach des Raumfahrzeugmontagegebäudes fotografiert wurde, zeigt den Start einer Falcon 9. Die Rakete steigt etwa 45 Minuten vor Sonnenaufgang nach Osten in den Himmel. In großer Höhe ist die Abgasfahne der Stufentrennung hell von der Sonne beleuchtet, die noch unter dem östlichen Horizont steht.
Die erste Stufe der Falcon-9-Rakete war zuvor schon einmal gestartet und hatte den Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) am 18. April – nur 72 Tage zuvor – in die Umlaufbahn gebracht. Bei diesem Start der SpaceX Commercial Resupply Service mission 15 (CRS-15) transportierte sie eine ebenfalls schon geflogene Dragon-Kapsel. Da jedoch keine weitere Wiederverwendung dieser Falcon 9 geplant war, folgte auf den Start keine dramatische Landung der ersten Stufe. Die Dragon-Kapsel erreichte die Internationale Raumstation am 2. Juli.