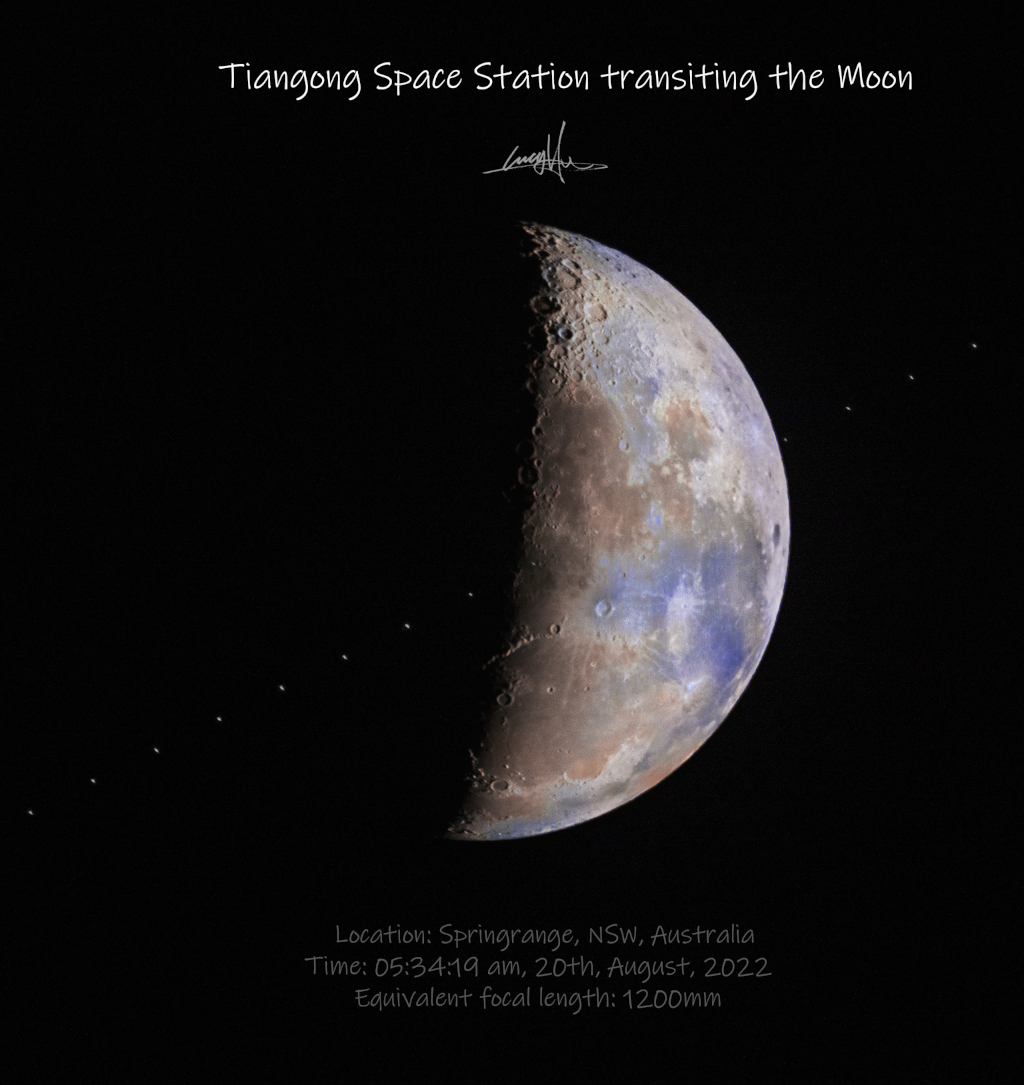Bildcredit und Bildrechte: David Jenkins
Im Inneren des Kokonnebels befindet sich ein neu entstehender Sternhaufen. Der schöne Nebel ist als IC 5146 katalogisiert und fast 15 Lichtjahre breit. Er ist etwa 4000 Lichtjahre entfernt und steigt am nördlichen Sommernachtshimmel im Sternbild Schwan (Cygnus) hoch hinauf.
Wie auch andere Sternbildungsregionen leuchtet er rot durch Wasserstoff, der von heißen jungen Sternen angeregt wird, sowie Sternenlicht, das vom Staub am Rand einer ansonsten unsichtbaren Molekülwolke reflektiert wird. Der helle Stern nahe der Mitte des Nebels ist wahrscheinlich erst ein paar hunderttausend Jahre alt. Er liefert die Energie für das Leuchten des Nebels und höhlt dabei das Sterne bildende Gas und den Staub der Molekülwolke aus.
Eine 29 Stunden lange Belichtung mit einem kleinen Teleskop in Ayr in der kanadischen Provinz Ontario führte zu dieser außergewöhnlich detailreichen Farbansicht, die faszinierende Details in und um das staubhaltige Sternentstehungsgebiet zeigt.