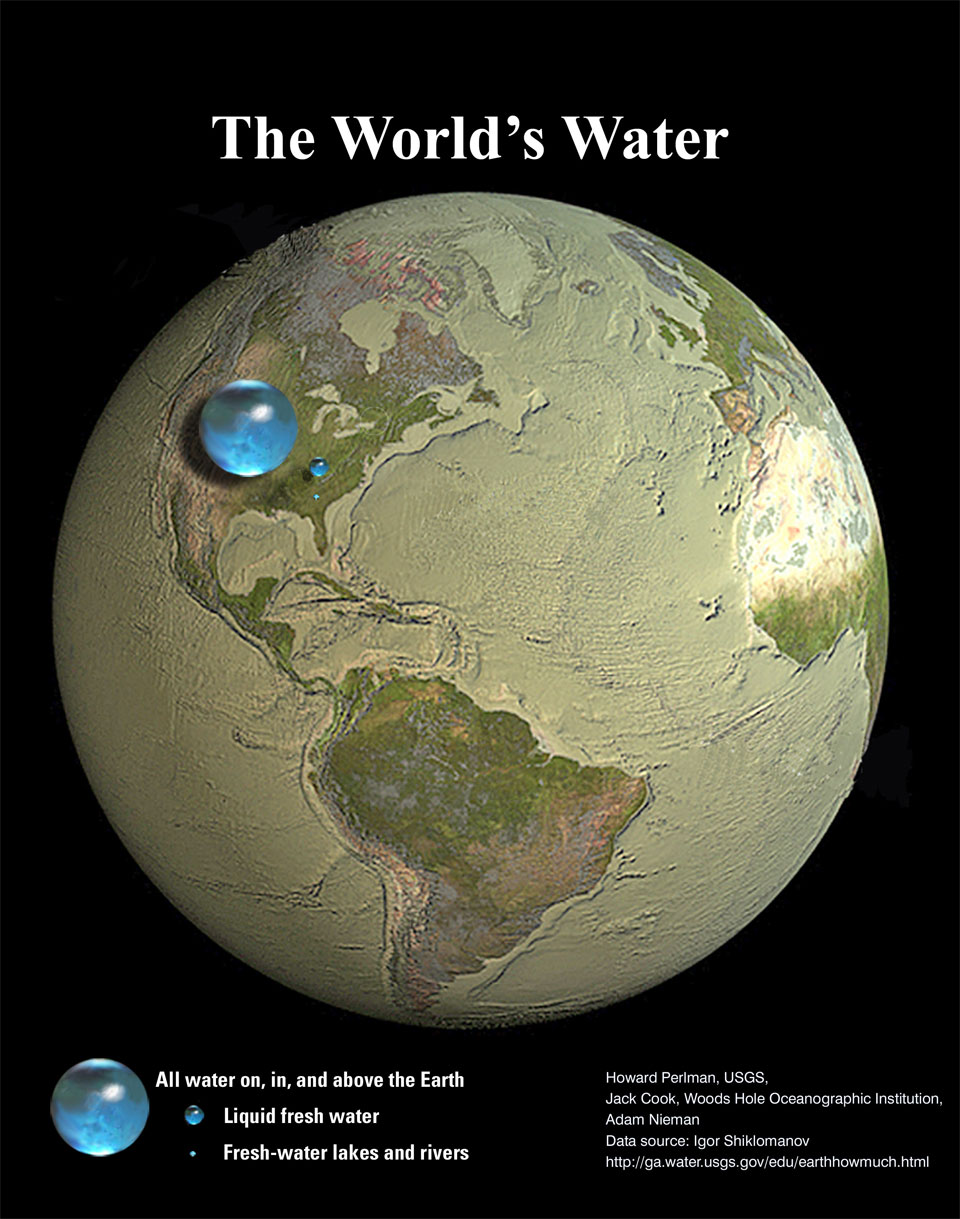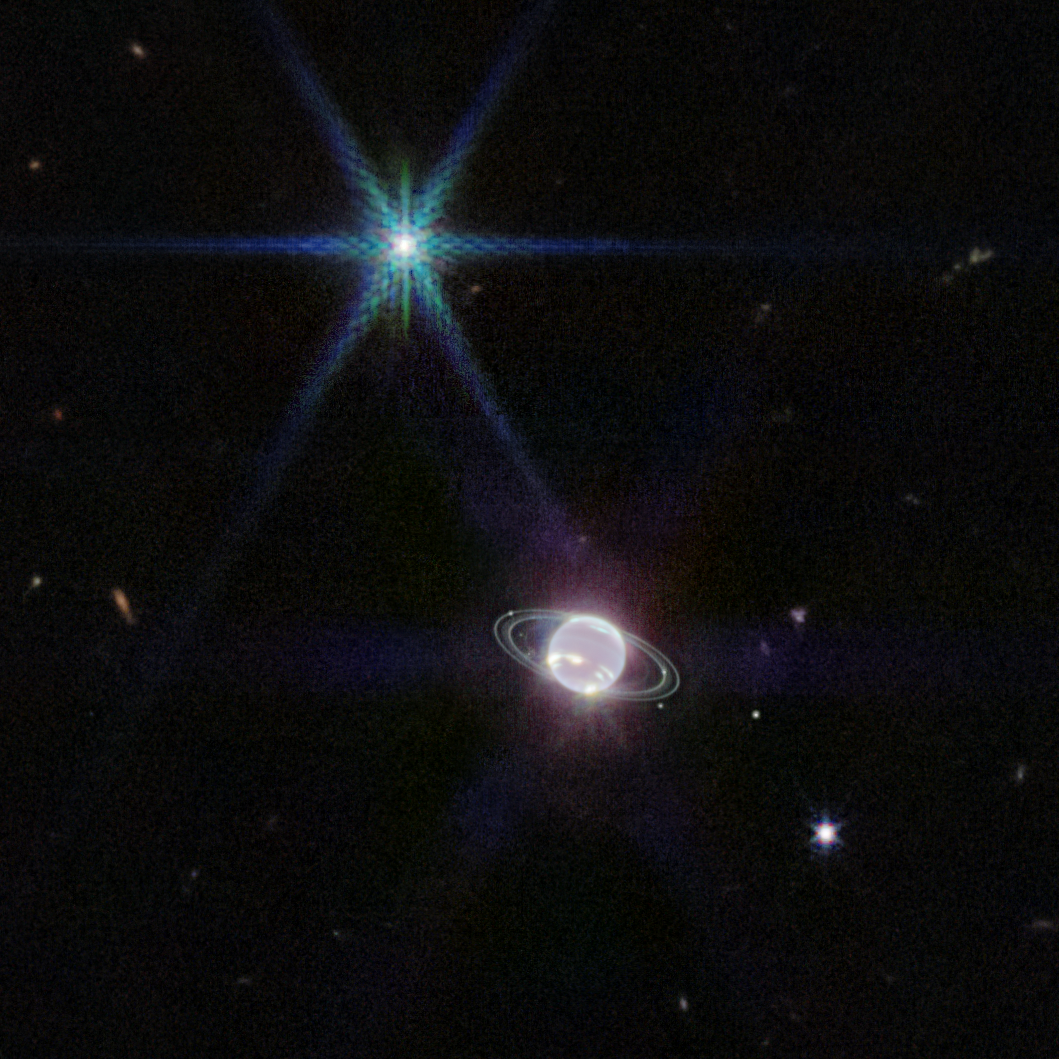Videocredit: NASA, JHUAPL, DART
Könnte die Menschheit einen Asteroiden ablenken, der Kurs auf die Erde nimmt? Ja. Gefährliche Einschläge großer Asteroiden gab es in der Vergangenheit der Erde schon öfter, manchmal führten sie zu Massensterben von Lebewesen.
Um die Erde vor einigen möglichen künftigen Einschlägen zu schützen, testete die NASA gestern einen neuen planetaren Schutzmechanismus, indem sie die Roboter-Raumsonde Double Asteroid Redirection Test (DART) auf Dimorphos stürzen ließ. Dimorphos ist ein kleiner, etwa 170 Meter großer Asteroid.
Wie dieses Video zeigt, war der Einschlag erfolgreich. Im Idealfall kann sogar der Stoß einer kleinen Raumsonde einen großen Asteroiden so weit ablenken, sodass er die Erde verfehlt, wenn die Sonde früh genug einschlägt. Das Zeitraffervideo zeigt, wie DART zuerst an größeren Didymos (links) vorbeifliegt und sich dann dem kleineren Asteroiden Dimorphos nähert.
Das Video endet abrupt mit dem Aufprall von DART, doch die Beobachtungen der veränderten Bahn des Asteroiden Dimorphos mit Raumsonden und Teleskopen auf der ganzen Erde haben bereits begonnen.