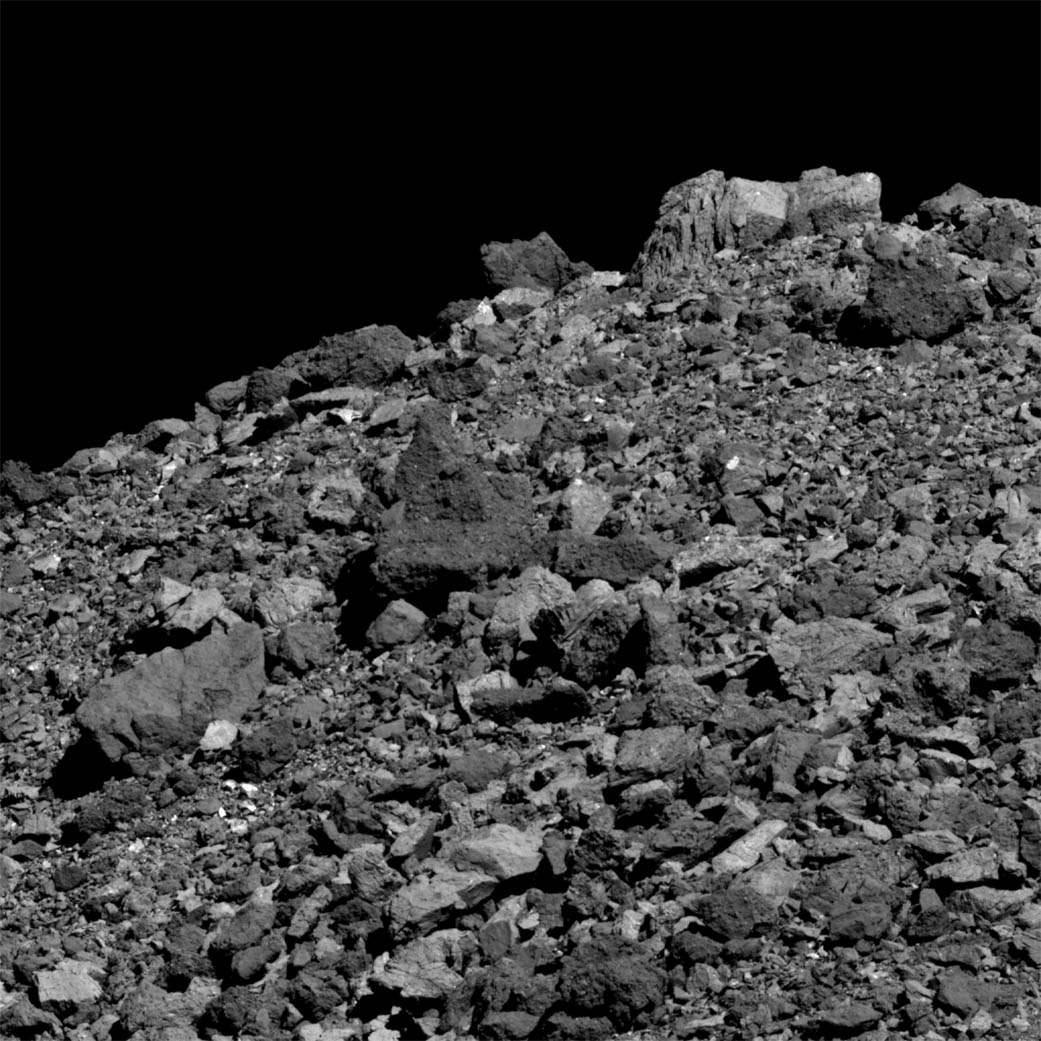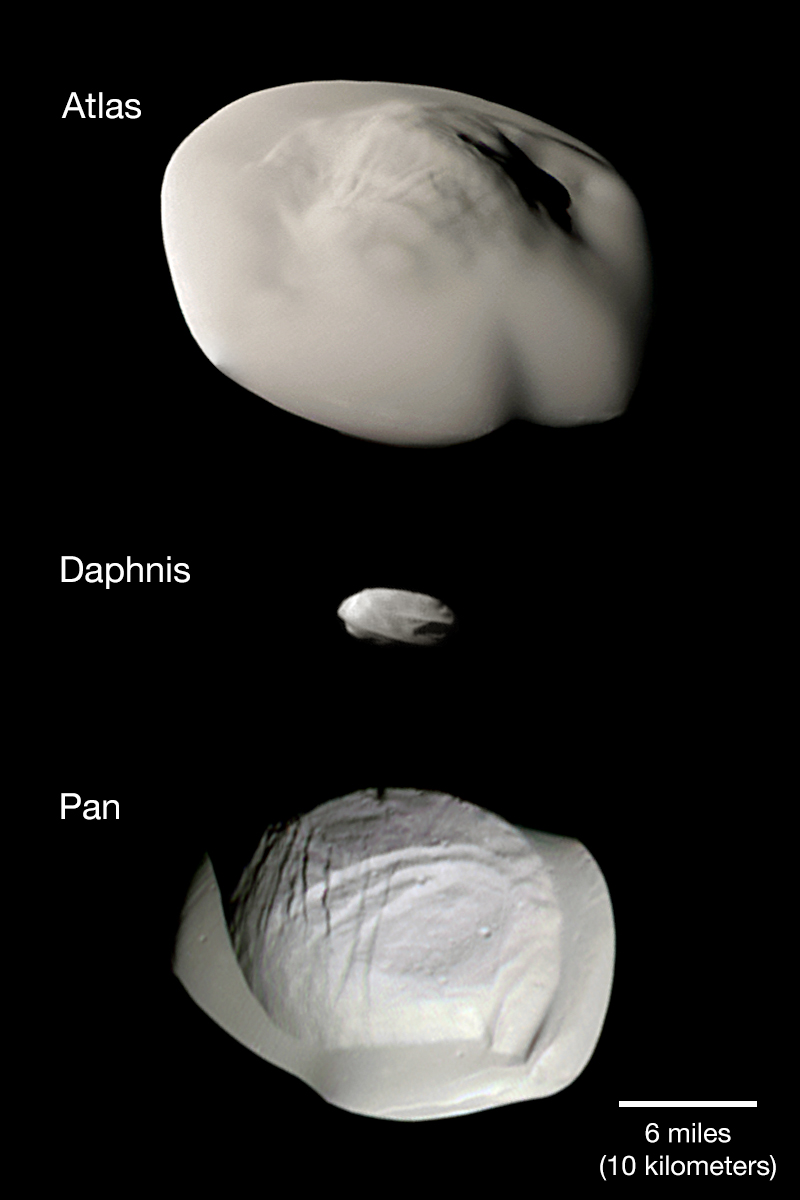Bildcredit und Bildrechte: Daniel Lopez (El Cielo de Canarias)
Beschreibung: Von welchem bizarren Planeten stammen diese fremdartigen Wesen? Natürlich nur vom Planeten Erde. Die Heimatgalaxie des Planeten – die Milchstraße – erstreckt sich über den dunklen Himmel dieser Fischaugen-Ganzhimmelsprojektion, die mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen wurde.
Die imposanten Formen, die himmelwärts blicken, kommen vielen Erdbewohnern vielleicht seltsam vor. Es sind rote Tajinasten auf der Kanarischen Insel Teneriffa im Nationalpark Teide. Diese Bedecktsamer werden bis zu 3 Meter hoch. Die Tajinasten blühen im Frühjahr und Frühsommer zwischen den Felsen des Vulkangeländes und sterben dann nach etwa einer Woche, wenn ihre Samen reifen. Die irdischen Lebensformen sind als Echium wildpretii bekannt und wurden während der Weitwinkelaufnahmen einzeln beleuchtet.