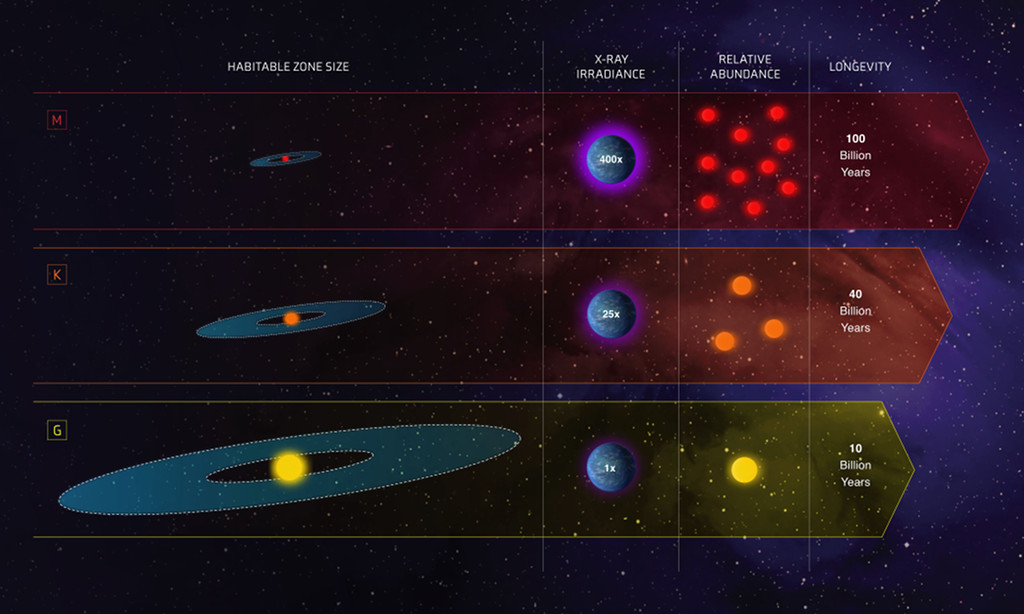Bildcredit: F. Pichardo, G. Hogan, P. Horálek, F. Hemmerich, S. Schraebler, L. Hašpl, R. Eder; Bearbeitung und Bildrechte: Matipon Tangmatitham; Text: Matipon Tangmatitham (NARIT)
Beschreibung: Sehen wir alle denselben Mond? Ja, aber wir sehen ihn verschieden. Ein Unterschied ist der scheinbare Ort des Mondes vor den Sternen im Hintergrund – ein Effekt, der als Parallaxe bezeichnet wird. Wir Menschen nützen die Parallaxe zwischen unseren Augen, um die Tiefe zu beurteilen. Um jedoch die Mondparallaxe zu schätzen, brauchen wir Augen, die viel weiter – Hunderte oder Tausende Kilometer – voneinander entfernt sind.
Ein weiterer Unterschied ist, dass Beobachter auf der ganzen Welt eine leicht abweichende Vorderseite unseres kugelförmigen Mondes sehen – ähnlich dem Effekt der Libration.
Das oben gezeigte Bild ist ein Komposit aus vielen Ansichten auf der ganzen Erde der totalen Mondfinsternis vom 21. Januar 2019, die bei APOD eingereicht wurden. Die Bilder wurden am gleichen Sternenhintergrund ausgerichtet, um beide Effekte zu veranschaulichen. Die exakte Gleichzeitigkeit dieser Aufnahmen wurde durch einen zufälligen Meteoriteneinschlag während der Mondfinsternis auf dem Mond möglich, er ist mit L1-21J beschriftet und garantiert, dass all diese eingesendeten Bilder im selben Sekundenbruchteil fotografiert wurden.