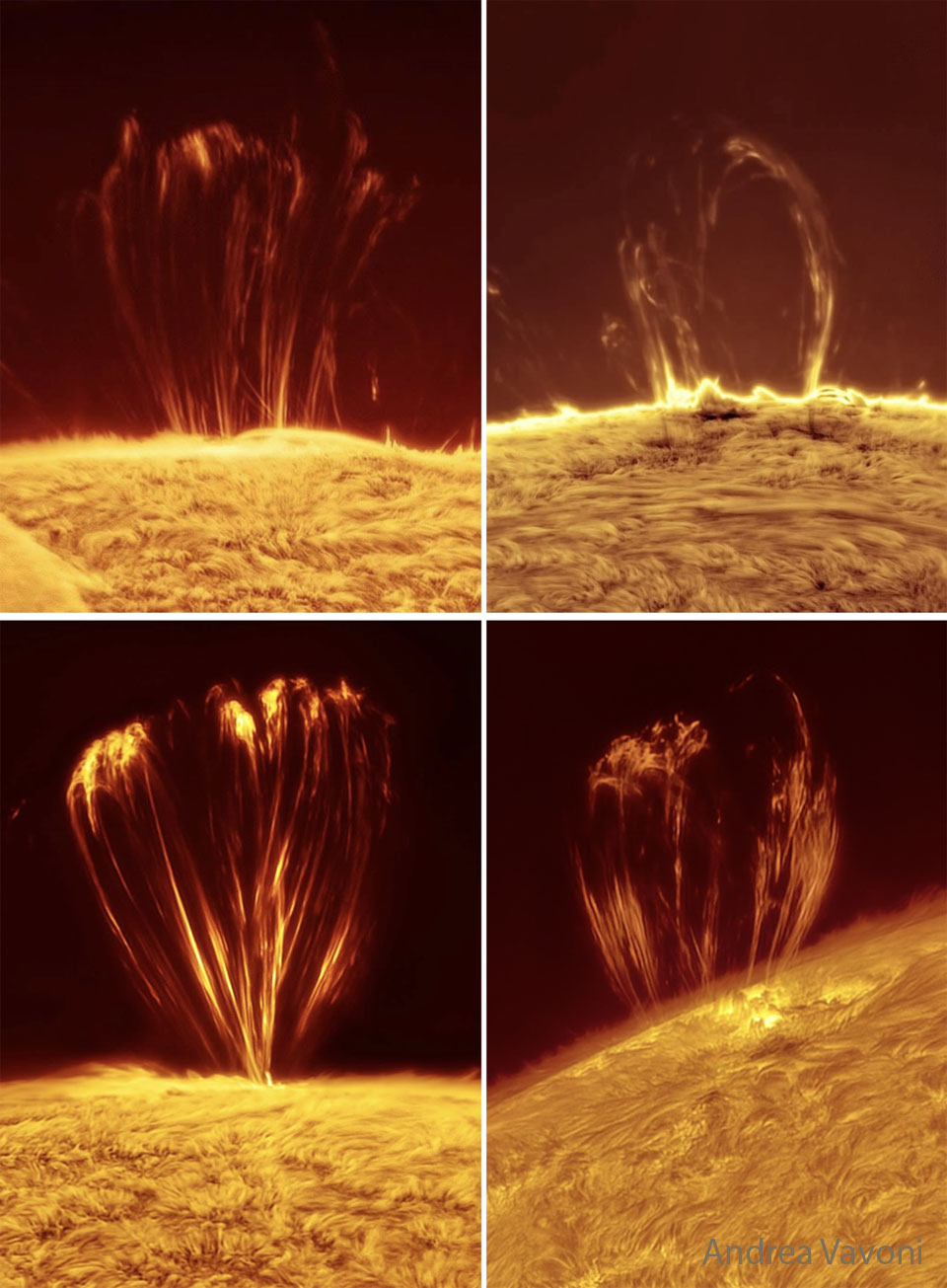Bildcredit: Ben Godson (Universität von Warwick)
Vor langer Zeit in einer 50 Millionen Lichtjahren entfernten Galaxie, da explodierte ein Stern. Das Licht dieser Supernova wurde bei uns auf der Erde aber erst am 14. Juli zum ersten Mal mit Teleskopen beobachtet. Sie ist derzeit die hellste Supernova am Nachthimmel und wurde von Astronomen Supernova 2025rbs benannt.
2025rbs wurde als Supernova vom Typ Ia erkannt. Diese Supernovae entstehen in Doppelsternsystem, wenn ein Weißer Zwerg Material von seinem Begleitstern aufnimmt. Das endet schließlich mit einer thermonuklearen Explosion. Supernovae vom Typ Ia dienen auch als Standardkerzen, mit denen man Entfernungen im Universum messen kann.
Die Heimatgalaxie von Supernova 2025rbs ist NGC 7331. Sie ist eine helle Spiralgalaxie und im nördlichen Sternbild Pegasus zu finden. NGC 7331 wird auch gerne als Pendant unserer Milchstraße bezeichnet.