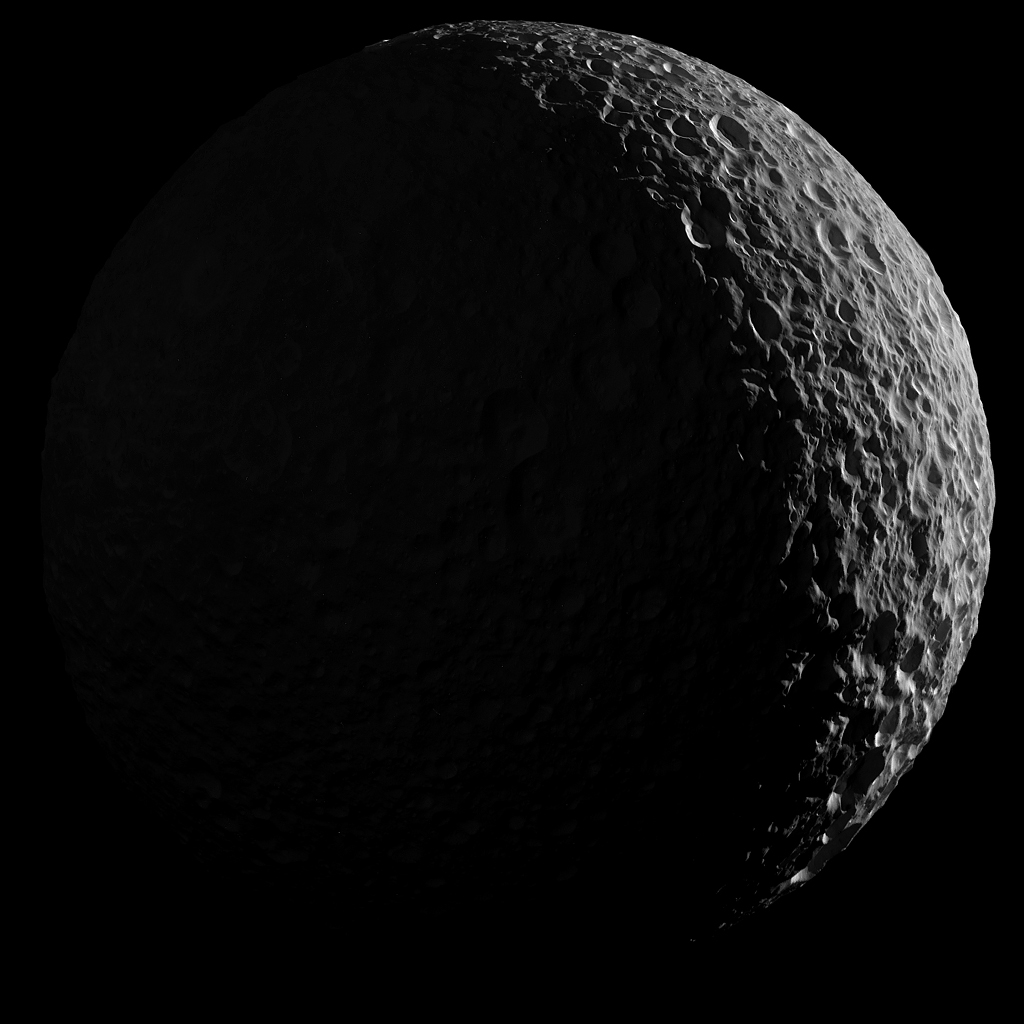Bildcredit und Bildrechte: Eric Coles und Mel Helm
Diese Landschaft am Himmel zeigt den staubigen Höhlennebel. Er ist im Sharpless-Katalog als Sh2-155 gelistet. Die Daten für das Teleskopbild wurden mit einem Schmalbandfilter gewonnen, der für das rötliche Licht ionisierter Atome von Wasserstoff durchlässig war.
Die Szene ist etwa 2400 Lichtjahre entfernt. Sie liegt in der Ebene unserer Milchstraße im königlichen nördlichen Sternbild Kepheus. Die astronomische Forschung zeigt, dass die Region am Rand einer massereichen Molekülwolke liegt. Sie heißt Kepheus-B und entstand mit den heißen jungen Sternen der Kepheus-OB3-Sternassoziation.
Der helle Grat aus ionisiertem Wasserstoff wird von der Strahlung der heißen Sterne angeregt. Der hellste Stern links über der Bildmitte sticht daraus hervor. Durch die Strahlung entstehen Ionisationsfronten. Sie führen wahrscheinlich zu kollabierenden Kernen und neuer Sternbildung im Inneren. Die kosmische Höhle ist für Sternbildung angemessen groß – sie misst mehr als 10 Lichtjahre.