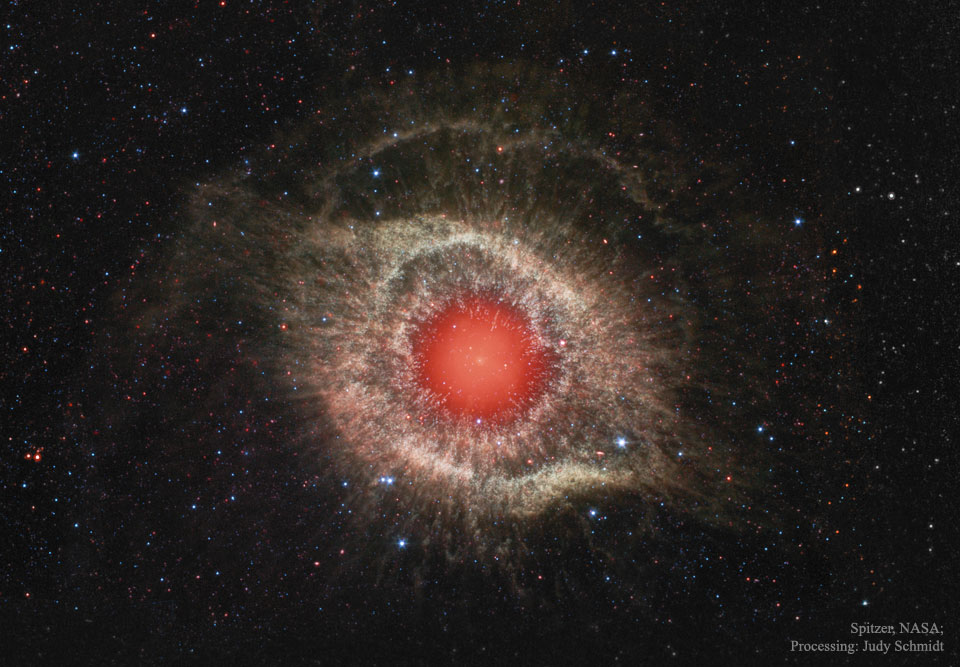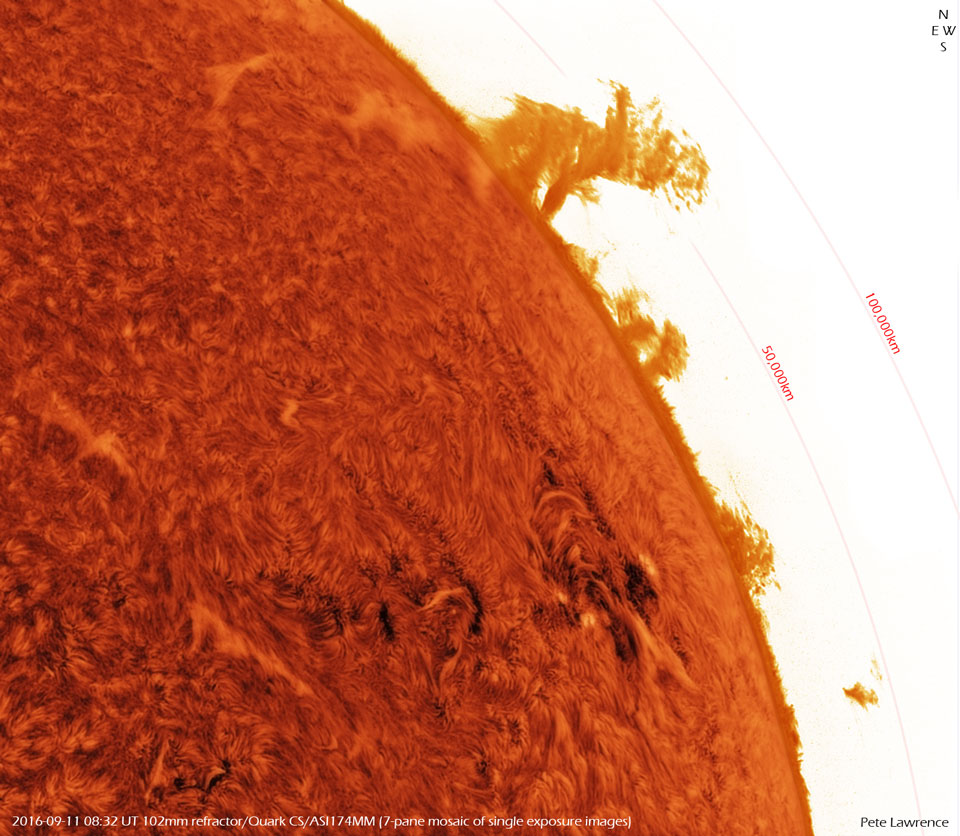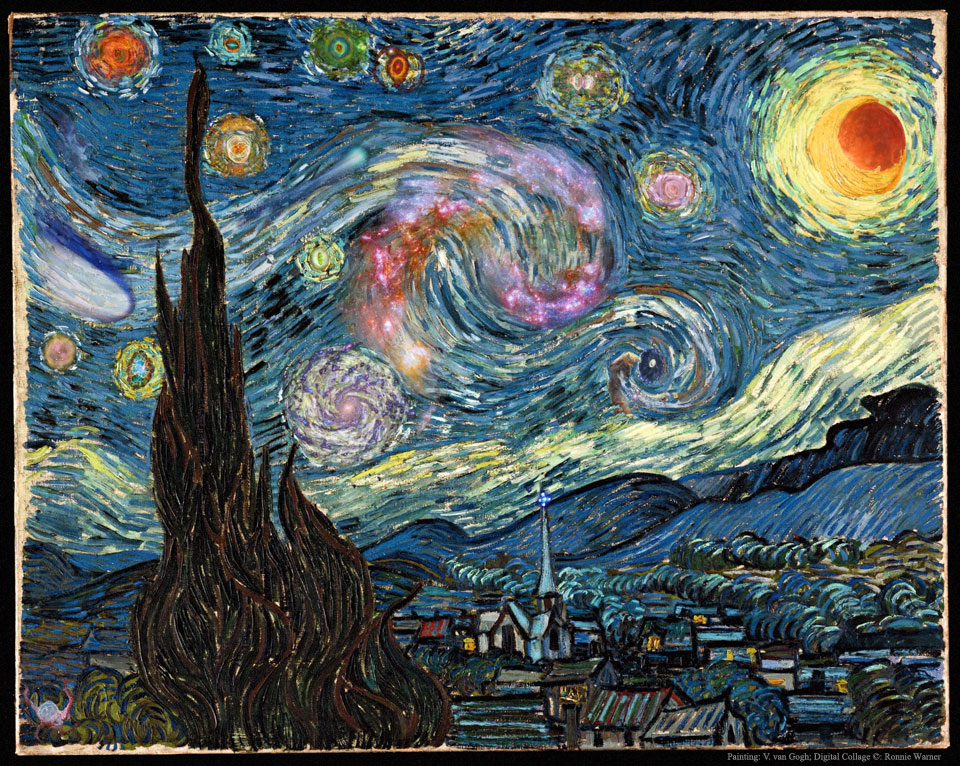Bildcredit und Bildrechte: Adrien Klamerius
Beschreibung: Dieses reiche Sternfeld am Himmel in den nördlichen Sternbildern Kassiopeia und Perseus ist fast 10 Grad groß. Links sind die herzförmigen kosmischen Wolken IC 1805 und IC 1848. Sie sind als Herz- und Seelennebel bekannt. Rechts sind die Sternhaufen NGC 869 und NGC 884. Man kann sie leicht erkennen. Sie heißen h und χ Persei oder einfach „der Doppelsternhaufen“. In Herz und Seele sind Haufen junger Sterne eingebettet. Sie sind etwa eine Million Jahre alt. Beide sind größer als 200 Lichtjahre. Sie sind sechs- bis siebentausend Lichtjahre entfernt. Die Nebel gehören zu einem großen aktiven Gebiet, in dem Sterne entstehen. Es liegt im Perseus-Spiralarm unserer Milchstraße. Der Doppelhaufen ist etwa gleich weit entfernt wie Herz- und Seelennebel. h und χ Persei sind nur wenige Hundert Lichtjahre voneinander entfernt. Sie liegen also physisch nahe beisammen und zirka 13 Millionen Jahre alt. Weil die Haufen so nahe beisammen liegen und ihre Sterne ähnlich alt sind, vermutet man, dass sie wahrscheinlich in derselben Sternbildungsregion entstanden sind.