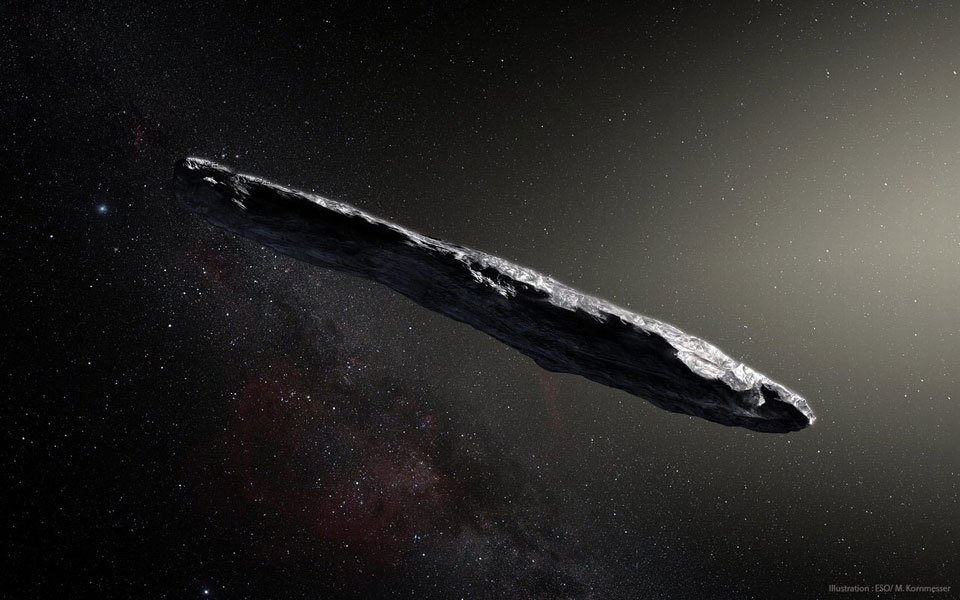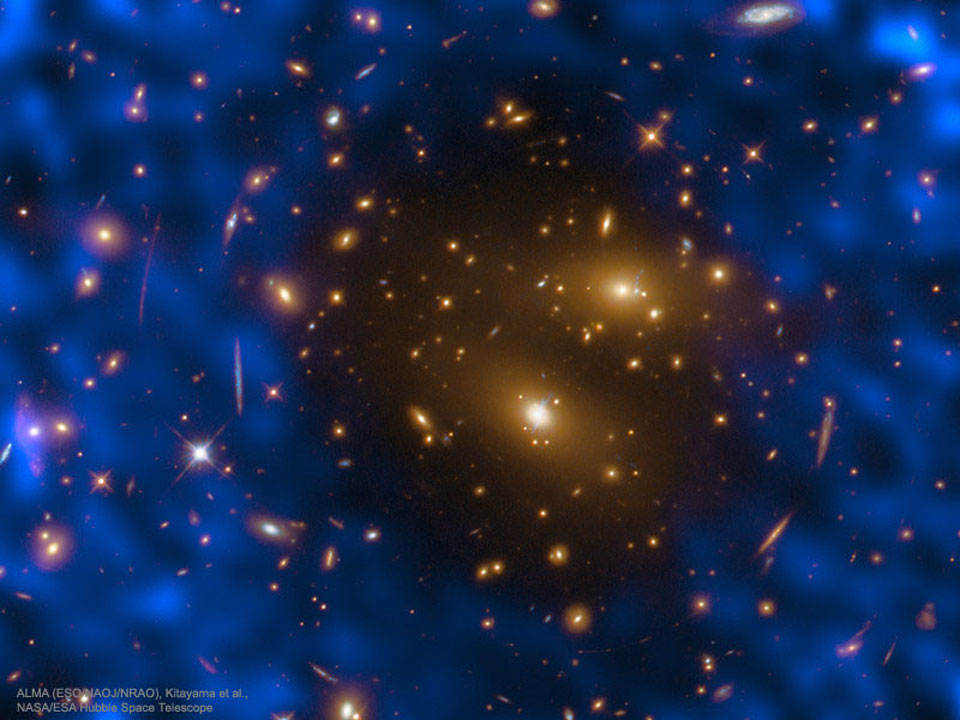Videocredit: NASA, CXC, Pontifical Catholic Univ. of Chile, C. Russell et al.
Was sieht man, wenn man aus dem Zentrum unserer Galaxis nach außen schaut? Dieses Video zeigt zwei wissenschaftlich ermittelte Möglichkeiten. Das immersive Video umfasst 360 Grad. Man kann es in jede Richtung drehen. Die Computersimulation basiert auf Infrarotdaten des Very Large Telescope (VLT) der ESO in Chile und Röntgendaten des NASA–Röntgenobservatoriums Chandra im Orbit.
Im Video erreicht ihr zu Beginn rasch Sgr A* (Sagittarius A Stern). Dort ist das sehr massereiche Schwarze Loch im Zentrum der Galaxis. Wenn ihr dann nach außen seht, zeigt die 500-Jahre-Zeitraffersimulation leuchtendes Gas und viele Lichtpunkte, die um euch kreisen. Viele der Punkte sind junge Wolf-Rayet-Sterne. Von diesen strömen sichtbare heiße Winde in die umgebenden Nebel.
Wolken, die näher kommen, werden länglich. Gleichzeitig fallen Objekte, die zu nahe kommen, hinein. Gegen Ende des Videos wiederholt sich die Simulation. Diesmal stößt die dynamische Region um Sgr A* heißes Gas aus, das die näher kommende Materie zurückstößt.