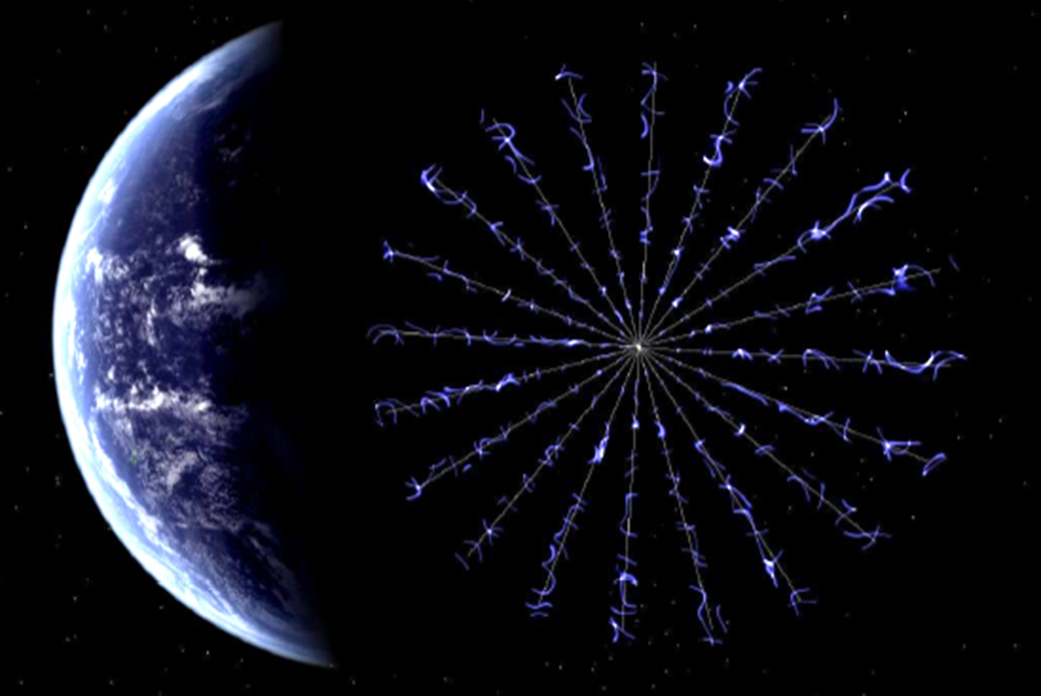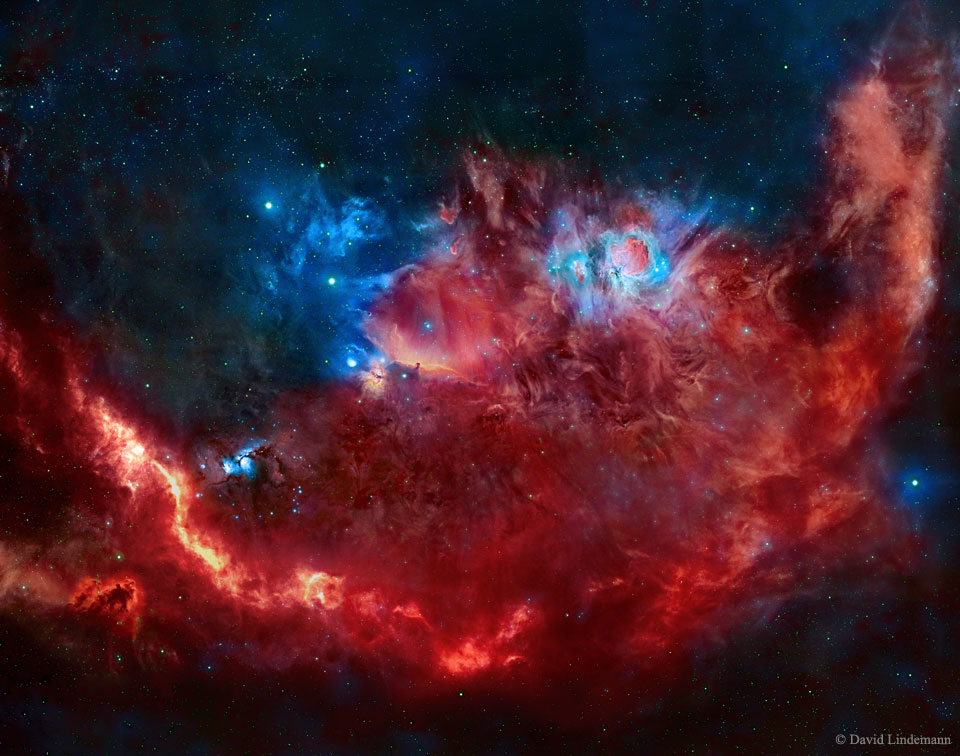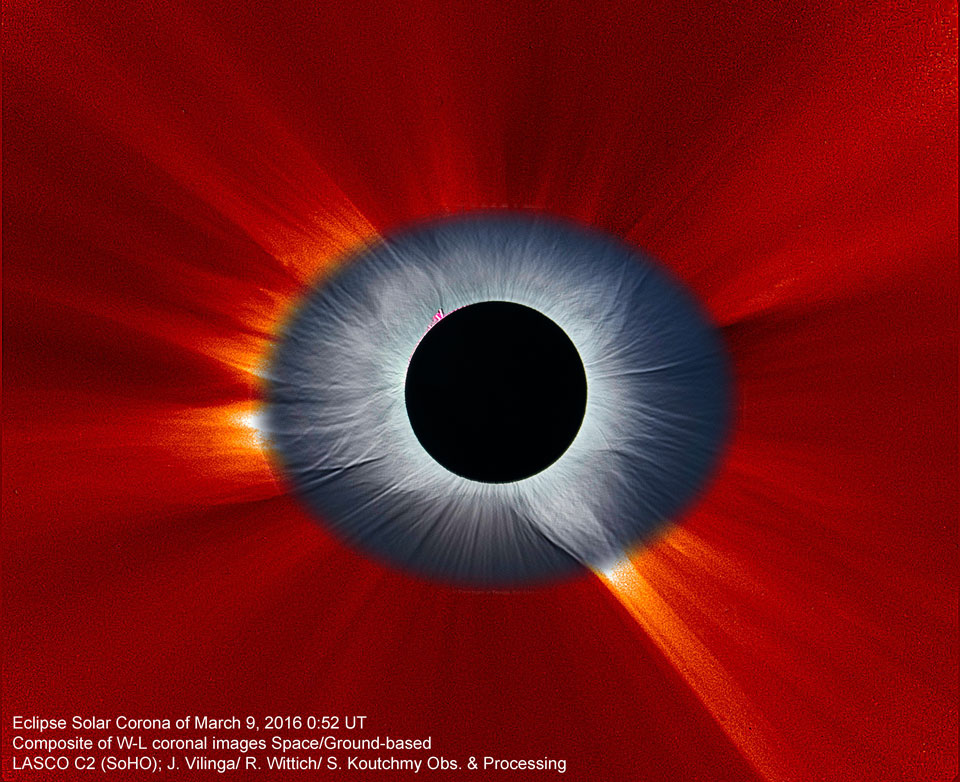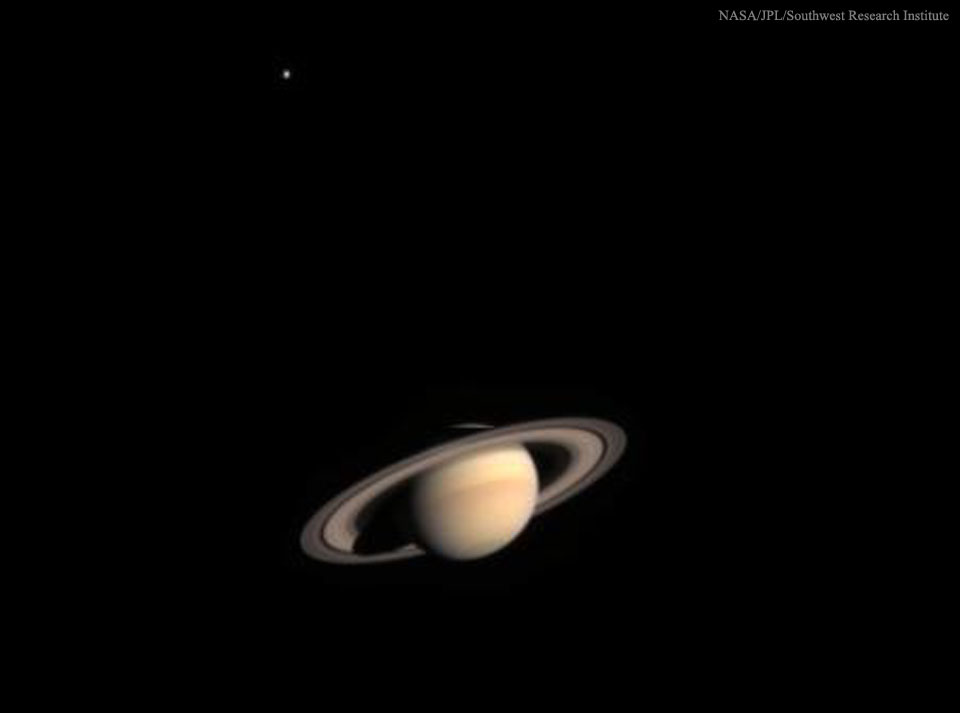Bildcredit und Bildrechte: Witta Priester
Was sind das für Wolken? Ihre Ursache ist derzeit unbekannt. Doch die ungewöhnlichen atmosphärischen Strukturen sind, so bedrohlich sie aussehen, keine Vorboten eines meteorologischen Untergangs. Informell heißen sie Undulatus asperatus. Ihre Erscheinung ist oft überwältigend und ihre Ausprägung ungewöhnlich. Die Wolken sind kaum untersucht. Sie wurden sogar als neue Wolkenart vorgeschlagen.
Die meisten niedrigen Wolkendecken haben eine flache Unterseite. Asperitas weisen stattdessen unten deutliche vertikale Strukturen auf. Es gibt daher Vermutungen, dass Asperitas mit Lenticularis oder Mammatus verwandt sind. Lenticularis entstehen in der Nähe von Bergen, Mammatus gehen mit Gewittern einher. Vielleicht sind sie auch eine Art Föhn. Das ist ein trockener Fallwind, der von Bergen hinabströmt.
Es gibt einen Wind, der Canterbury Northwester genannt wird. Er strömt zur Ostküste von Neuseelands Südinsel. Dieses Bild wurde 2005 über Hanmer Springs in Canterbury (Neuseeland) fotografiert. Es ist sehr detailreich, weil das Sonnenlicht die gewellten Wolken von der Seite beleuchtet.