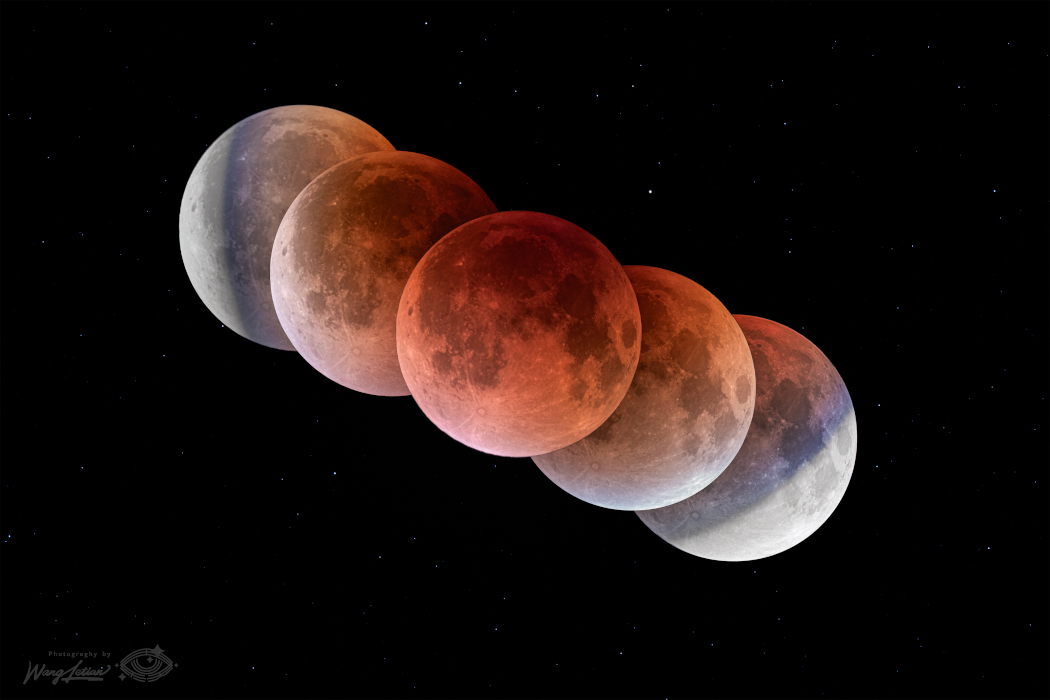Video Credit: NASA, Animation: James O’Donoghue (U. Reading)
Wie dreht sich euer Lieblingsplanet? Dreht er sich schnell um eine fast senkrechte Achse, waagrecht oder rückwärts? Dieses Video animiert NASA-Bilder von allen acht Planeten im Sonnensystem. Man sieht, wie sie sich nebeneinander drehen. Das macht einen einfachen Vergleich möglich.
Im Zeitraffer-Video dauert ein Tag auf der Erde – das ist eine Erdumdrehung – nur wenige Sekunden. Jupiter dreht sich am schnellsten, während sich die Venus nicht nur am langsamsten dreht (sie dreht sich wirklich, genau hinschauen!), sondern auch rückwärts. Die inneren Gesteinsplaneten oben erlebten in den Anfängen des Sonnensystems dramatische Kollisionen, die ihre Drehung und Neigung veränderten.
Warum sich Planeten so drehen und neigen, wie sie es tun, wird nach wie vor erforscht. Moderne Computermodelle und die jüngste Entdeckung und Analyse von Hunderten von Exoplaneten – das sind Planeten, die andere Sterne umkreisen – lieferten viele neue Erkenntnisse.